



Wir sind mehr als ein nur ein Haufen Experten. Bei uns verschmelzen Intelligenz und Herzlichkeit zu einer Gemeinschaft. In unserer Zusammenarbeit spürt man das Miteinander, die Freude und das Feuer, das uns antreibt. Unser Blog gewährt dir Einblicke – nicht nur in unsere Köpfe, sondern auch in unsere Herzen. Erlebe Erfahrungswerte und Einsichten, direkt aus dem Herzen der Praxis für die Anwendung in der Praxis.
Organisationsentwicklung
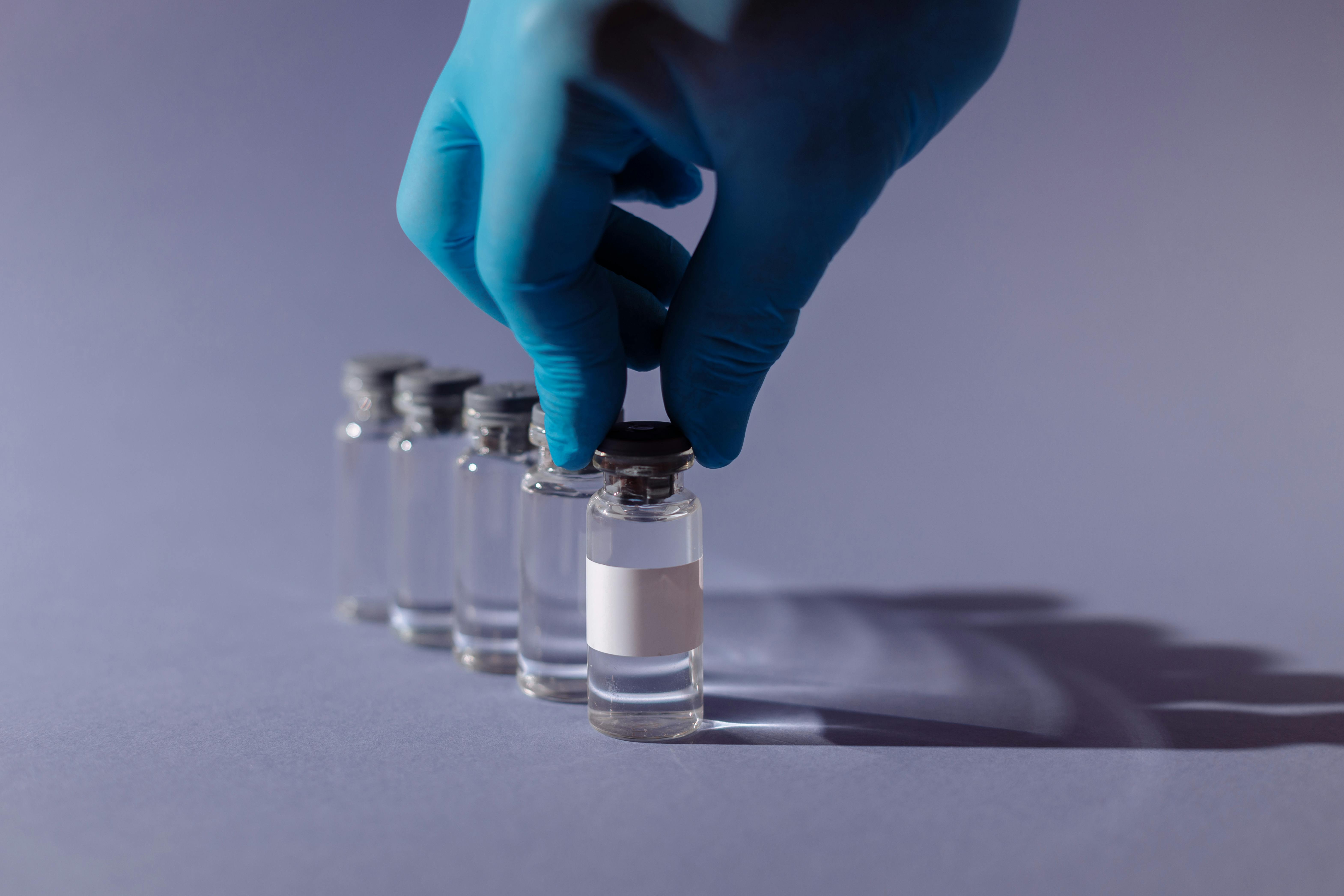
Foto von Thirdman auf pexels.com
Analyse der Wirksamkeit interner Beratung und des organisationalen Absorptionsdrucks
Von Marcus Winterfeldt
In einer zunehmend von Komplexität und rasanten Veränderungen geprägten Arbeitswelt gewinnt die interne Organisationsberatung als strategische Funktion zur Begleitung von Lern- und Veränderungsprozessen stetig an Bedeutung. Sie agiert an der Schnittstelle von Individuum, Team und Gesamtorganisation und hat das Potenzial, enorme Kapazitäten für die Selbstorganisations- und Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens zu erschließen. Doch gerade mit dieser strategischen Relevanz wächst auch der Druck, die eigene Wirksamkeit nachzuweisen. Dieser Nachweis ist nicht nur für die Legitimation der Beraterfunktion und die Allokation von Ressourcen entscheidend, sondern dient auch als zentrales Steuerungsinstrument zur qualitativen Weiterentwicklung der eigenen Interventionen. In der Praxis stößt der Versuch einer validen Wirksamkeitsmessung jedoch auf fundamentale methodische und theoretische Herausforderungen, die tief in der Natur komplexer sozialer Systeme verwurzelt sind.
Die Spannung zwischen dem berechtigten Anspruch auf Transparenz und evidenzbasiertes Handeln einerseits und den realen Gegebenheiten organisationaler Beratungsprozesse andererseits ist beträchtlich. Die Schwierigkeit, kausale Ursache-Wirkungs-Ketten zu isolieren, die Heterogenität der Erfolgskriterien und die kontextuelle Einbettung jeder Intervention machen simple Evaluationsmodelle unbrauchbar. Die folgende Analyse beleuchtet diese Komplexität, indem sie zunächst die grundlegenden methodischen Probleme der Wirksamkeitsforschung im Beratungskontext detailliert darstellt und die Grenzen linear-kausaler Messlogiken aufzeigt.
Der Wunsch, die Wirksamkeit von Beratung durch klare, kausale Nachweise zu belegen, ist verständlich und folgt einer wissenschaftlichen Logik, die in vielen Disziplinen als Goldstandard gilt. Jedoch gerät dieser Ansatz an seine Grenzen, wenn er auf die Realität komplexer sozialer Systeme wie Organisationen trifft. Die grundlegende Spannung zwischen dem Ideal des kontrollierten Experiments und der eigendynamischen, vernetzten Natur organisationaler Prozesse stellt die Beratungsforschung vor erhebliche methodische Herausforderungen. Ein strategisches Verständnis dieser Grenzen ist entscheidend, um realistische Erwartungen an Evaluationsstudien zu formulieren und die Wirksamkeit von Beratung angemessen zu bewerten. Gerade weil eine simple, lineare Kausalität nicht nachweisbar ist, rückt die Frage nach der systemischen Positionierung und der Rollenarchitektur des Beraters ins Zentrum der Wirksamkeitsanalyse.
Die zentrale Schwierigkeit bei der Messung von Beratungswirkung liegt in der Natur organisationaler Systeme selbst. Aus systemtheoretischer Sicht sind Organisationen als autopoietische, also sich selbst erzeugende und selbstreferenzielle Kommunikationssysteme zu verstehen. Sie reagieren auf externe Impulse – wie eine Beratungsintervention – nicht in einer deterministischen Ursache-Wirkungs-Kette, sondern gemäß ihrer eigenen internen Logik, ihrer Geschichte und ihrer aktuellen Zustände (Bachmann & Loermann, 2021). Die Wirksamkeit einer Intervention ist somit fundamental vom intervenierten System selbst abhängig.
Aus dieser Erkenntnis folgt, dass Beratung nicht als direkte, steuernde Einflussnahme verstanden werden kann, die ein vorhersagbares Ergebnis produziert. Vielmehr zielt eine systemische Intervention primär darauf ab, das System zu „irritieren“ oder „Anstöße“ zu geben. Solche Impulse können die etablierten Muster und Selbstbeschreibungen der Organisation verstören und so die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung neuer, konstruktiver Muster erhöhen (Bachmann & Loermann, 2021). Ob und wie das System diese Irritation verarbeitet, bleibt jedoch seiner Selbstorganisation überlassen und ist von außen prinzipiell nicht voraussehbar.
Wenn nun versucht wird, diese komplexen, nicht-linearen Phänomene mit traditionellen, linear-kausalen Forschungsmethoden wie dem Randomized Controlled Trial (RCT) zu messen, muss ein „theoretischer Kompromiss“ eingegangen werden (Bachmann & Loermann, 2021). Man misst systemische Phänomene mit einer Methodik, deren Grundannahmen (z. B. isolierbare Variablen, kontrollierbare Bedingungen) der Natur des Untersuchungsgegenstandes widersprechen. Dies führt zwangsläufig zu einer methodischen Verzerrung und einer Vereinfachung, die der Realität nur unzureichend gerecht wird.
Die Isolation einzelner Wirkfaktoren wird zusätzlich dadurch erschwert, dass jede Intervention in einen hochgradig vernetzten organisationalen Kontext eingebettet ist. Effekte sind selten das Resultat einer einzelnen Ursache, sondern entstehen aus dem Zusammenspiel unzähliger, oft nicht kontrollierbarer Einflussfaktoren. Zudem verlaufen Veränderungsprozesse in Organisationen typischerweise nicht linear, sondern in zirkulär kausalen Dynamiken, in denen Wirkungen wieder zu Ursachen werden und sich gegenseitig verstärken oder abschwächen (Kosfelder, 2019).
Bachmann & Loermann (2021) fassen die daraus resultierenden methodischen Probleme prägnant zusammen:
Die Unmöglichkeit, homogene Stichproben zu ziehen: Jede Organisation ist einzigartig in ihrer Kultur, Geschichte und Struktur, was Vergleiche zwischen verschiedenen Systemen erschwert.
Die Uneinheitlichkeit und damit Nicht-Vergleichbarkeit der Interventionen: Beratungsprozesse werden auf den spezifischen Kontext zugeschnitten und sind daher selten standardisierbar.
Die Perspektivenabhängigkeit der Wirkungen: Was aus der Sicht des Managements ein Erfolg ist (z. B. Effizienzsteigerung), kann von Mitarbeitenden als erhöhter Druck und Misserfolg wahrgenommen werden.
Vielfältige nicht-kontrollierbare Einflussfaktoren: Marktveränderungen, Personalfluktuation oder interne politische Verschiebungen können die Ergebnisse einer Beratung maßgeblich beeinflussen, ohne dass dies im Forschungsdesign kontrolliert werden kann.
Selbst wenn man die Kausalitätsproblematik temporär ausklammert, bleibt die Frage, was genau als „Erfolg“ gemessen werden soll. Die Forschung zeigt, dass es kein einheitliches Erfolgskriterium gibt. Stattdessen existieren verschiedene Ebenen der Erfolgsmessung, die jeweils eigene methodische Herausforderungen mit sich bringen (vgl. Kosfelder, 2019; Widmer, 2018).
Objektive Veränderungsmessung - Prä-Post-Differenzwerte: Die Berechnung der Veränderung von Kennzahlen vor und nach der Beratung. Herausforderung: Erhöhter statistischer Messfehler durch Mehrfachmessungen; eine statistisch signifikante Veränderung sagt noch nichts über die praktische Relevanz aus.
Subjektive Beurteilung - Retrospektive Veränderungsbefragungen: Klienten schätzen rückblickend das Ausmaß ihrer Veränderung ein. Herausforderung: Starke Anfälligkeit für subjektive Verzerrungen und Erinnerungsfehler.
Subjektive Beurteilung - Globale Zufriedenheitsurteile: Einfache Befragungen zur Zufriedenheit mit der Beratung. Herausforderung: Geringe psychometrische Güte; es ist unklar, ob die Zufriedenheit tatsächlich auf die Beratungswirkung oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist.
Zielerreichung - Zielerreichungsskalierungen (Goal Attainment Scaling): Vorab definierte, individuelle Ziele werden auf einer Skala bewertet. Herausforderung: Die individuellen Ziele sind zwischen verschiedenen Klienten kaum vergleichbar, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt.
Die entscheidende Erkenntnis aus der Therapieforschung, die sich auf die Beratung übertragen lässt, ist die weitgehende Unabhängigkeit dieser Erfolgsebenen. Eine Studie von Michalak, Kosfelder et al. (2003) konnte zeigen, dass das objektiv berechnete Ausmaß einer Verbesserung (Differenzwerte) kaum mit der subjektiven Zufriedenheit der Klienten oder der eingeschätzten Zielerreichung korreliert. Für die Bewertung interner Beratung bedeutet dies: Ein Projekt kann aus organisationaler Sicht (z. B. anhand von KPIs) erfolgreich sein, während die beteiligten Personen unzufrieden sind und ihre individuellen Ziele als nicht erreicht betrachten – und umgekehrt. Eine eindimensionale Erfolgsmessung greift daher immer zu kurz.
Trotz dieser erheblichen methodischen Hürden lassen sich in der Forschung spezifische Wirkfaktoren identifizieren, die insbesondere für die Praxis der systemischen internen Beratung von hoher Relevanz sind und im folgenden Abschnitt erörtert werden.
Systemische Beratung ist nicht primär als ein „Methodenkoffer“ zu verstehen, aus dem je nach Bedarf ein passendes Werkzeug gewählt wird. Vielmehr handelt es sich um eine spezifische, theoriegeleitete Haltung und eine besondere Art der Beobachtung, die auf den Prinzipien der Systemtheorie und des Konstruktivismus basiert (Bachmann & Loermann, 2021). Sie geht davon aus, dass Probleme durch die Muster des Zusammenspiels in einem System aufrechterhalten werden und Lösungen aus den Ressourcen des Systems selbst entstehen müssen. Für die Steigerung der Effektivität interner Beratung ist es daher von strategischer Wichtigkeit, die aus dieser Haltung resultierenden, spezifischen Wirkfaktoren zu kennen und gezielt zu nutzen.
Obwohl eine lineare Kausalitätsmessung schwierig ist, hat die Wirksamkeitsforschung eine Reihe von Faktoren identifiziert, die in systemischen Interventionen konsistent mit positiven Ergebnissen in Verbindung gebracht werden. Basierend auf der Analyse von Bachmann & Loermann (2021) lassen sich folgende zentrale Wirkfaktoren zusammenfassen:
Hypothesenbildung und Perspektiverweiterung: Die Fähigkeit des Beraters, auf Basis unterschiedlicher theoretischer „Landkarten“ (z. B. systemtheoretische Modelle) Hypothesen über die Funktionslogik der Organisation zu bilden, ist ein Kernprozess. Indem der Berater diese Hypothesen und bewusst unterschiedliche, auch widersprüchliche Perspektiven in die Kommunikation einbringt, regt er die Organisation an, ihre eigenen Selbstbeschreibungen zu hinterfragen und neue Sichtweisen zu entwickeln.
Kontextsensitivität und Anschlussfähigkeit: Wirksame Interventionen müssen zum spezifischen organisationalen Kontext passen. Dies erfordert ein tiefes Verständnis für die Kultur, die Kommunikationsmuster und die impliziten Regeln der Organisation. Der Wirkfaktor des Kontext-Reframings bezeichnet die Fähigkeit, Probleme in ihrem organisationalen Zusammenhang neu zu deuten. Entscheidend ist zudem die Gestaltung anschlussfähiger Interventionen, also solcher Impulse, die von der Eigendynamik des Systems aufgenommen und verarbeitet werden können, anstatt auf Widerstand zu stoßen oder wirkungslos zu verpuffen.
Gezielte Irritation: Anstatt Lösungen vorzugeben, besteht die zentrale Interventionslogik darin, etablierte Muster gezielt zu verstören und Irritationen auszulösen. Dies geschieht durch Interventionen, die die gewohnten Kommunikations- und Entscheidungsroutinen unterbrechen. Erfolgt diese Irritation zum passenden Zeitpunkt, kann sie die Selbstorganisation des Systems anregen und den Weg für neue, konstruktive Muster ebnen.
Förderung von Reflexivität: Eine Schlüsselfunktion des Beraters liegt in der Schaffung von Reflexionsräumen. Er fördert die Beobachtung zweiter Ordnung, also die Fähigkeit der Organisation, sich selbst bei der Art und Weise zu beobachten, wie sie Probleme konstruiert und bearbeitet. Durch das Anregen dieser Selbstbeobachtung werden implizite Annahmen und „blinde Flecken“ sichtbar, was die Grundlage für organisationales Lernen schafft.
Die Bedingungen, unter denen interne Berater agieren, unterscheiden sich fundamental von denen externer Kollegen. Diese Unterschiede in der organisationalen Positionierung, den Erwartungsstrukturen und der Einflussmacht modifizieren die Wirkungsweise der oben genannten Faktoren erheblich.
Die permanente Anwesenheit und formale Zugehörigkeit eines internen Beraters zum Organisationssystem kann die Anschlussfähigkeit signifikant erhöhen. Durch detailliertes Wissen über informelle Netzwerke, die Organisationskultur und die „politische Landkarte“ können interne Berater Interventionen oft passgenauer gestalten als Externe. Gleichzeitig birgt genau diese Nähe eine erhebliche Gefahr: Die Fähigkeit zur neutralen Beobachtung und zur wirksamen Irritation kann gefährdet sein. Die Einbindung in bestehende Hierarchien, Loyalitätserwartungen und soziale Beziehungen kann die für eine Intervention notwendige Distanz und „Fremdheit“ untergraben.
Diese inhärente Ambivalenz der internen Position macht eine detaillierte Analyse der multiplen Rollen und systemischen Funktionen des Beraters zwingend erforderlich, um seine Wirksamkeit zu verstehen.
Die Wirksamkeit interner Berater hängt maßgeblich davon ab, wie sie ihre Rolle im Organisationssystem definieren und die damit verbundenen, inhärenten Spannungen navigieren. Eine unklare oder widersprüchliche Rollengestaltung führt nicht nur zu Verunsicherung aufseiten der Klienten und des Beraters selbst, sondern kann die intendierte Wirkung von Interventionen neutralisieren. Die strategische Bedeutung einer bewussten und klar kommunizierten Rollenarchitektur kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Interne Berater bewegen sich konstant in einem Spannungsfeld, das durch mindestens drei konkurrierende Rollenerwartungen definiert wird:
Die Rolle des Fachexperten: In dieser Rolle wird vom Berater erwartet, dass er spezifisches Wissen einbringt und konkrete Lösungen für identifizierte Probleme liefert. Dies entspricht der klassischen Expertenberatung, bei der das Klientensystem die Bearbeitung eines Anliegens an das Beratersystem delegiert (vgl. Zirkler, 2005; Widmer, 2018).
Die Rolle des Prozessgestalters: Hier agiert der Berater nicht als Inhaltslieferant, sondern als Vermittler, der die Organisation befähigt, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe und die Stärkung der Problemlösekompetenz des Klientensystems, was dem Kern der Prozessberatung entspricht (vgl. Zirkler, 2005; Widmer, 2018).
Die Rolle des Mitglieds: Als Angestellter der Organisation ist der interne Berater Teil des Systems, das er berät. Er ist in formale Hierarchien und informelle Netzwerke eingebunden, unterliegt Loyalitätserwartungen und teilt eine gemeinsame organisationale Realität.
Empirische Befunde von Hoffmann (1991) zeigen, dass interne Berater tendenziell eine direktive „Problemlöser“-Rolle (Expertenrolle) bevorzugen (vgl. Hoffmann, 1991, S. 101). Diese Präferenz korrespondiert häufig mit dem organisationalen Druck nach schnellen, messbaren Ergebnissen, der den Ruf nach einfachen „Wirkungsnachweisen“ verstärkt und damit die systemische Grundhaltung untergräbt. Für interne Berater wird dieses Spannungsfeld durch ihre Zugehörigkeit zur Organisation weiter verkompliziert. Die Erwartung, schnell „nützliche“ und sichtbare Lösungen zu liefern, kann den Raum für prozessorientierte Begleitung, die oft langsamer und weniger direktiv verläuft, erheblich einschränken.
Ein zentraler Mechanismus systemischer Wirksamkeit ist die „Koppelung von Berater- und Klientensystem“ (Bachmann & Loermann, 2021). Dieser systemtheoretische Begriff beschreibt eine Form der Verbindung zwischen zwei ansonsten operational geschlossenen Systemen, die es ermöglicht, dass Ereignisse im einen System als relevante Informationen (Irritationen) im anderen System verarbeitet werden können. Ohne eine solche strukturelle Kopplung bleiben Interventionen für das Klientensystem bedeutungslos.
Genau hier liegt eine der größten potenziellen Stärken interner Berater. Durch ihre permanente Präsenz, ihre formale und informelle Einbindung und ihre leichtere Zugänglichkeit können sie eine besonders enge und dichte strukturelle Kopplung zum Klientensystem herstellen. Sie verstehen die „Sprache“ der Organisation, kennen die relevanten Akteure und die impliziten Entscheidungsprämissen. Diese enge Kopplung ist die strukturelle Voraussetzung für jene hohe „Anschlussfähigkeit“, die Bachmann & Loermann (2021) als zentralen Wirkfaktor identifizieren. Dadurch können interne Berater Resonanzen erzeugen und Impulse setzen, die für externe Berater, die nur temporär und punktuell andocken, oft schwerer zu erreichen sind.
Während diese enge Kopplung die Anschlussfähigkeit und damit die potenzielle Wirksamkeit steigern kann, birgt sie gleichzeitig die zentrale Gefahr der Vereinnahmung durch das System. Diese wird im folgenden Kapitel systemtheoretisch als „Absorptionsdruck“ analysiert.
Der „Absorptionsdruck“ kann als das zentrale professionelle Risiko für interne Berater definiert werden. Er beschreibt die systemische Tendenz der Organisation, den internen Berater so stark in ihre bestehenden Routinen, Kommunikationsmuster und Rationalitäten zu integrieren, dass dieser seine wirksamkeitsstiftende Differenz zum System verliert. Die strategische Relevanz dieses Phänomens ist fundamental: Wenn der Absorptionsdruck überwiegt, wird der Berater lediglich zu einem weiteren Rädchen im bestehenden Getriebe, reproduziert die vorhandene Logik und neutralisiert damit seine eigentliche Funktion, Impulse für Veränderung und Lernen zu setzen.
Der primäre systemtheoretische Mechanismus zur Erklärung dieser Vereinnahmungsgefahr wird von Mingers als das Phänomen der „konfluierenden Differenzen“ beschrieben. Die zentrale These lautet:
„Die zunehmende Ähnlichkeit der Sichtweisen von Klientensystem/Auftraggeber und Beratersystem lässt die Differenz von Fremd und Selbst verschwimmen und an Signalcharakter für hilfreiche bzw. ‚notwendige‘ Interventionen verlieren.“ (Mingers, 1996, S. 279, zitiert nach Zirkler, 2005, S. 26)
Durch die permanente Einbindung in die Organisation nähert sich die Perspektive des internen Beraters (Beratersystem) unweigerlich der des Klientensystems an. Die Fähigkeit, alternative Beobachtungen zu machen und „fremde“ Perspektiven einzunehmen, erodiert. Laut Mingers (1996) wird dieser Prozess durch bestimmte Voraussetzungen begünstigt und führt zu spezifischen, die Wirksamkeit untergrabenden Folgen:
Routinen: Die Einbindung in die täglichen Abläufe und Kommunikationsroutinen des Klientensystems.
Starre Kontextualisierung: Eine enge, unflexible Definition des Beratungskontextes, die alternative Sichtweisen von vornherein ausschließt.
Zementierung bestehender Latenzen: Verdeckte Konflikte oder dysfunktionale Muster werden nicht thematisiert, sondern durch die angepasste Sichtweise des Beraters unbewusst stabilisiert.
Nicht-erfolgende Interventionen: Da die notwendige Differenz fehlt, um ein Problem als solches zu erkennen oder eine alternative Handlungsmöglichkeit zu sehen, unterbleiben entscheidende Impulse für Veränderung.
Eine zu enge Einbindung des internen Beraters in die operativen und politischen Dynamiken der Organisation führt, abgeleitet aus der Theorie der konfluierenden Differenzen, zu gravierenden Konsequenzen für seine Wirksamkeit:
Verlust der kritischen Distanz: Die Fähigkeit zur Beobachtung zweiter Ordnung – also die Fähigkeit, die Muster der Organisation von außen zu betrachten – geht verloren. Der Berater wird „betriebsblind“.
Verringerung der Irritationsfähigkeit: Anstatt die Systemlogik zu hinterfragen und zu irritieren, reproduziert der Berater sie. Dies führt zu den von Mingers (1996) beschriebenen „nicht-erfolgenden Interventionen“, dem Kern des Wirkungsverlustes.
Rollendiffusion und Loyalitätskonflikte: Die notwendige Abgrenzung zwischen der Beraterrolle und der Rolle als Kollege oder Mitarbeiter verschwimmt. Der Berater wird in Loyalitätskonflikte verstrickt, die seine Unparteilichkeit und damit seine Glaubwürdigkeit untergraben.
Gefährdung der Wirksamkeit: Die zentrale Funktion, dem System neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, wird neutralisiert. Der Berater mag zwar beschäftigt und akzeptiert sein, seine eigentliche transformative Wirkung geht jedoch verloren.
Die Professionalität interner Berater zeigt sich maßgeblich in ihrer Fähigkeit, dem Absorptionsdruck aktiv entgegenzuwirken und eine konstruktive Differenz zum Klientensystem bewusst aufrechtzuerhalten. Dies erfordert eine proaktive Gestaltung der eigenen Rolle und Arbeitsweise.
Systematische Reflexion und Meta-Supervision: Regelmäßige Supervision oder kollegiale Intervision ist kein optionales „Add-on“, sondern ein notwendiges Instrument zur Qualitätssicherung. Sie ermöglicht dem Berater, die eigene Position, die Dynamik der Koppelung an das Klientensystem und die Gefahr der Vereinnahmung aus einer Metaperspektive zu reflektieren und die verlorene Beobachterdistanz wiederherzustellen.
Explizite Rollen- und Mandatsklärung: Eine klar definierte Problem- und Aufgabenstellung zu Beginn eines jeden Mandats ist entscheidend (vgl. Sommerlatte, 2000, S. 226). Befristete und klar abgegrenzte Mandate helfen, eine schleichende, funktionale Vereinnahmung zu verhindern. Der Berater muss seine Rolle und die Grenzen seiner Verantwortung immer wieder aktiv kommunizieren und aushandeln.
Bewusste Selbstentkopplung und Grenzziehung: Dies beschreibt eine aktive professionelle Haltung, die eigenen Beobachtungen und die Routinen sowie Erwartungen der Organisation immer wieder zu hinterfragen. Es geht darum, die für wirksame Irritationen notwendige „Fremdheit“ bewusst zu kultivieren, indem man sich gezielt aus dem operativen Tagesgeschäft herausnimmt und den Kontakt zu externen professionellen Netzwerken pflegt, um die eigene Perspektive zu schärfen.
Die Kunst der internen Beratung liegt somit in der paradoxen Fähigkeit, eine Balance zwischen der für die Anschlussfähigkeit notwendigen Kopplung an das System und der für die Wirksamkeit entscheidenden professionellen Distanz herzustellen und aufrechtzuerhalten.
Die Analyse hat die inhärente Komplexität der Wirksamkeit interner Beratung beleuchtet. Sie bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem legitimen Anspruch auf evidenzbasierte Praxis und der systemischen Realität, in der lineare Ursache-Wirkungs-Zuschreibungen an ihre Grenzen stoßen. Interne Beratung ist kein mechanisches Werkzeug zur Problemlösung, sondern ein anspruchsvoller Prozess der Anregung organisationaler Selbstorganisation, dessen Erfolg von einer fragilen Balance zwischen Nähe und Distanz abhängt.
Die systemtheoretische Perspektive macht deutlich, dass die Wirksamkeit interner Beratung in komplexen, selbstorganisierten Systemen prinzipiell probabilistisch statt deterministisch bleibt. Eine Intervention kann die Bedingungen für eine konstruktive Musterveränderung verbessern und die Wahrscheinlichkeit für organisationales Lernen erhöhen, sie kann dieses aber niemals garantieren oder erzwingen. Jede Organisation verarbeitet Impulse gemäß ihrer eigenen Logik. Die Aufgabe des internen Beraters besteht darin, als Katalysator zu fungieren, der durch gezielte Irritationen und die Förderung von Reflexivität Versuche anstößt, „Lösungen wahrscheinlicher zu machen“ (Bachmann & Loermann, 2021, S. 4). Die Verantwortung für die tatsächliche Veränderung verbleibt jedoch immer im Klientensystem selbst.
Aus der gesamten Analyse lassen sich drei entscheidende Bedingungen destillieren, die die Wirksamkeit interner Beratung nachhaltig erhöhen. Sie bilden zusammen eine Art „Architektur der Differenz“, die es dem Berater ermöglicht, seine einzigartige Funktion im System zu entfalten, ohne von diesem absorbiert zu werden.
Eine geklärte Rollenarchitektur: Nachhaltige Wirksamkeit erfordert die bewusste Gestaltung und proaktive Kommunikation der internen Beraterrolle im Spannungsfeld zwischen Mitgliedschaft, Fachexpertise und Prozessbegleitung. Eine unklare Rolle führt unweigerlich zu dysfunktionalen Dynamiken und Wirkungsverlust.
Die Kultivierung von Distanz und Reflexivität: Der zentrale Hebel zur Sicherung der Wirksamkeit ist die Etablierung von organisationalen und persönlichen Praktiken (z. B. klare Mandatierung, regelmäßige Supervision), die eine kritische Distanz zum Klientensystem gewährleisten. Nur so kann eine Vereinnahmung durch „konfluierende Differenzen“ verhindert und die für Interventionen notwendige Beobachterperspektive aufrechterhalten werden.
Die Balance von Anschlussfähigkeit und Irritation: Die höchste Kunst interner Beratung liegt in der Fähigkeit, eine paradoxe Position einzunehmen: Durch eine enge strukturelle Kopplung und tiefes Kontextverständnis muss der Berater für das System relevant und anschlussfähig sein. Gleichzeitig muss er aber genau jene professionelle Differenz und „Fremdheit“ bewahren, die es ihm erlaubt, durch das Einbringen neuer Perspektiven die entscheidenden Impulse für Lernen und Entwicklung zu setzen.
Organisationsentwicklung

Foto von Leeloo The First auf pexels.com
Eine systemtheoretische und forschungskritische Analyse
Von Marcus Winterfeldt
Der Markt für Organisationsberatung ist von einem bemerkenswerten Paradoxon geprägt: Einerseits erlebt die Branche einen anhaltenden Boom und eine intensive Nachfrage von Organisationen, die in einer immer komplexeren Welt nach Orientierung und Effektivität streben. Andererseits bleibt die tatsächliche Wirksamkeit von Beratungsleistungen oft intransparent und ist empirisch kaum fundiert. Diese Diskrepanz wird in der Fachliteratur seit Jahren konstatiert. Es herrscht ein spürbares Defizit an grundlegenden Arbeiten und einer schlüssigen, empirisch abgestützten Beratungstheorie, die über anekdotische Erfolgsberichte und Modewellen hinausgeht (Zirkler, Sperling/Ittermann). Die Branche floriert, während ihre wissenschaftliche Fundierung lückenhaft bleibt.
Das Ziel dieses Beitrags ist es, eine kritische und zugleich konstruktive Analyse der Wirksamkeit von Organisationsberatung zu liefern. Basierend auf systemtheoretischen Überlegungen und einer kritischen Würdigung der Wirksamkeitsforschung werden die fundamentalen methodischen Herausforderungen, die spezifischen Wirkmechanismen systemischer Ansätze und die zentralen Risiken für die professionelle Praxis von Beraterinnen und Beratern beleuchtet. Dieser Bericht soll damit einen Beitrag leisten, die Reflexionsfähigkeit von Praktikern zu schärfen und die Diskussion über eine professionelle, theoriegeleitete Beratungspraxis zu fördern.
Um die spezifischen Wirkfaktoren und Risiken zu verstehen, ist es jedoch unerlässlich, zunächst die fundamentalen methodischen Probleme zu erörtern, mit denen jede ernsthafte Wirksamkeitsforschung in diesem Feld konfrontiert ist.
Die Untersuchung der Wirksamkeit von Organisationsberatung steht vor grundlegenden methodischen Hürden, die eine einfache Übertragung von Forschungsdesigns aus anderen Disziplinen, wie etwa der Medizin oder der Pharmaforschung, unmöglich machen. Das Paradigma des klinischen Versuchs, das auf klar definierte Interventionen und messbare, isolierbare Effekte angewiesen ist, greift in der komplexen, dynamischen und kontextabhängigen Realität von Organisationen zu kurz. Eindeutige kausale Wirkungsnachweise sind hier kaum zu erbringen, was die Forschung vor erhebliche Herausforderungen stellt.
Der Goldstandard zum Nachweis kausaler Wirkungen in der Pharmaforschung ist der Randomized Controlled Trial (RCT). Bei diesem experimentellen Design werden Versuchspersonen zufällig (randomisiert) einer Behandlungs- und einer Kontrollgruppe zugewiesen. Idealerweise wissen weder die Behandelnden noch die Behandelten, wer das wirksame Präparat und wer ein Placebo erhält (Doppelblindstudie). Unterschiede, die nach der Intervention zwischen den Gruppen gemessen werden, können so eindeutig auf die Wirkung des Medikaments zurückgeführt werden.
In der Beratungsforschung ist ein solches Vorgehen aus mehreren Gründen kaum anwendbar (Kosfelder):
Unmöglichkeit der "Verblindung": Beraterinnen und Berater wissen naturgemäß, welches Beratungsmodell sie anwenden. Eine Verblindung ist hier ausgeschlossen.
Ethische Bedenken: Klienten in eine Wartegruppe einzuteilen, um ihnen eine notwendige Unterstützung vorzuenthalten, ist ethisch höchst fragwürdig.
Störfaktoren: Menschliche Faktoren wie Erwartungen, Hoffnungen und die Qualität der Arbeitsbeziehung lassen sich experimentell nicht kontrollieren. Sie sind jedoch oft entscheidende Wirkfaktoren und nicht bloß Störvariablen.
Als praktikablere, aber in ihrer Aussagekraft deutlich limitierte Alternative bieten sich quasi-experimentelle Designs an. Diese versuchen, die fehlende Randomisierung durch zusätzliche Messzeitpunkte (z.B. Vorher-Nachher-Messungen) oder nicht-randomisierte Kontrollgruppen auszugleichen. Sie erlauben jedoch keine kausalen Schlussfolgerungen, sondern können lediglich Hinweise auf Veränderungen im Zusammenhang mit einer Intervention liefern (Kosfelder).
2.2. Kontextabhängigkeit und die Heterogenität der Erfolgskriterien
Ein weiteres Kernproblem liegt darin, dass die Wirksamkeit von Beratung extrem kontextabhängig ist. Eine Intervention, die in einer Organisation erfolgreich ist, kann in einer anderen scheitern. Der Erfolg hängt von einer Vielzahl nicht-kontrollierbarer Einflussfaktoren ab, wie der Organisationskultur, der Motivation der Beteiligten oder externen Marktentwicklungen (Bachmann & Loermann).
Darüber hinaus leidet die Forschung an der Heterogenität der Erfolgskriterien. Was als "Erfolg" gilt, hängt maßgeblich von der Perspektive des Bewertenden ab:
Das Unternehmen mag den Erfolg an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie dem Return on Investment (ROI) messen.
Die beauftragende Führungskraft könnte die Zielerreichung im Projekt als zentrales Kriterium sehen.
Die beteiligten Mitarbeitenden bewerten den Prozess möglicherweise anhand ihrer Zufriedenheit oder der Verbesserung des Arbeitsklimas.
Es gibt keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe, was die Vergleichbarkeit von Studien massiv erschwert (Widmer, Künzli & Seiger, Greif).
Aus systemtheoretischer Sicht liegt das grundlegendste Problem im Versuch, komplexe, zirkuläre und nicht-lineare Phänomene mit linear-kausalen Methoden zu messen (Bachmann & Loermann). Organisationen werden hier als autopoietische, also sich selbst organisierende und erhaltende soziale Systeme verstanden. Solche Systeme lassen sich nicht von außen zielgerichtet steuern. Interventionen können daher immer nur als "Irritationen" oder Anregungen verstanden werden, die vom System nach seiner eigenen Logik verarbeitet werden.
Die Wirksamkeit von Interventionen ist in solchen Systemen prinzipiell kaum voraussehbar (Simon via Bachmann & Loermann). Ein Berater kann lediglich die Wahrscheinlichkeit für Musterveränderungen erhöhen, aber niemals einen bestimmten Effekt garantieren. Der Versuch, dies mit klassischen Ursache-Wirkungs-Modellen zu erfassen, verfehlt die Eigendynamik und Komplexität des Gegenstandes.
Diese methodischen Grundprobleme machen deutlich, dass ein anderes Verständnis von Wirkung und Intervention notwendig ist. Der systemische Ansatz bietet hierfür einen theoretischen Rahmen, dessen spezifische Wirkmechanismen im Folgenden beleuchtet werden.
Der Begriff "systemisch" beschreibt nicht, wie oft fälschlich angenommen, ein bestimmtes Methodenrepertoire, sondern markiert eine theoretische Fundierung. Er kennzeichnet eine Theorie, die als "Landkarte der Beobachtung" dient (Simon via Bachmann & Loermann). Wer systemisch denkt, nutzt systemtheoretische und konstruktivistische Modelle, um Hypothesen über die Entstehung und Aufrechterhaltung von Phänomenen in sozialen Systemen zu bilden. Aus dieser veränderten Beobachtung ergeben sich andere Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen als bei der Nutzung anderer Theorien. Systemische Praxis ist somit "umgesetzte Erkenntnistheorie" (von Schlippe & Schweitzer).
Systemisches Arbeiten basiert auf einer spezifischen Haltung und zentralen theoretischen Annahmen, die die Interventionen anleiten.
Beobachtung zweiter Ordnung: Systemische Beraterinnen und Berater reflektieren permanent ihre eigene Rolle und Teilnahme am Beratungsprozess. Sie beobachten nicht nur das Klientensystem, sondern auch, wie sie selbst durch ihre Anwesenheit und ihre Unterscheidungen die Wirklichkeit im Beratungssystem mitkonstruieren (von Schlippe & Schweitzer).
Die Rolle der Irritation: Da eine direkte Steuerung von Organisationen als selbstreferenziellen Systemen nicht möglich ist, zielen Interventionen nicht auf die Implementierung einer vorgefertigten Lösung. Ihr Ziel ist es, das Klientensystem zu "irritieren" – also Impulse und neue Informationen einzuspielen, die gewohnte Muster unterbrechen und die Entwicklung neuer, hilfreicherer Muster wahrscheinlicher machen (Bachmann & Loermann).
Organisationen als Kommunikationssysteme: Die systemische Perspektive rückt von den Individuen ab und fokussiert stattdessen auf die Kommunikationsmuster, die eine Organisation als soziales System konstituieren. Dies definiert den Interventionsgegenstand eines Organisationsberaters im Unterschied zu einem Therapeuten: Er blickt "durch die Person hindurch auf die Kommunikationsmuster und Entscheidungsregeln", um die Organisationswirklichkeit zu verstehen und zu beeinflussen (Willke via Zirkler).
Obwohl die Wirksamkeitsforschung methodisch herausfordernd ist, hat eine umfassende Literaturanalyse von Bachmann & Loermann eine Reihe von empirisch dokumentierten Wirkfaktoren systemisch-konstruktivistischer Organisationsberatung identifiziert. Diese lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
Anwendung systemischer Modelle:
Hypothesenbildung auf Basis unterschiedlicher systemtheoretischer "Landkarten"
Arbeit mit Leitdifferenzen (z.B. Problem/Lösung, alt/neu) zur Strukturierung der Beobachtung
Bewusste Gestaltung der Koppelung von Berater- und Klientensystem
Anschlussfähige Interventionen, die an die Logik des Klientensystems anknüpfen
Gestaltung des Beratungssystems:
Eine systemische Grundhaltung (z.B. Neugier, Respekt, Allparteilichkeit)
Ein kompetenter Umgang mit Komplexität, Widersprüchen und Paradoxien
Spezifische Interventionen:
Das gezielte Auslösen von Irritationen
Die Förderung der Selbstorganisation im Klientensystem
Das Schaffen von Transparenz und das Besprechbarmachen von Tabuthemen
Das Einbringen von Perspektivenvielfalt und die Anregung zur mehrdimensionalen Beobachtung
Der systemische Ansatz unterscheidet sich fundamental von berufs- oder individualpsychologischen Ansätzen wie klassischem Coaching oder Psychotherapie, auch wenn sich die angewandten Methoden teilweise ähneln. Die Psychotherapieforschung hat allgemeine Wirkfaktoren wie die therapeutische Beziehung oder die Ressourcenaktivierung identifiziert (Grawe via Roth & Ryba), die auch in der Beratung relevant sind. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Fokus der Intervention:
Individualpsychologische Ansätze konzentrieren sich auf intrapsychische Prozesse des Individuums (z.B. Kognitionen, Emotionen, Persönlichkeitsmerkmale).
Systemische Ansätze legen den Fokus dezidiert auf die Interaktionsmuster, die Kommunikationsstrukturen und die zugrundeliegende Logik des sozialen Systems (z.B. Team, Abteilung, Organisation). Das Individuum wird als Teil dieses Systems verstanden, dessen Verhalten im Kontext der systemischen Dynamiken Sinn ergibt.
Diese spezifische Haltung und der Fokus auf das System als Ganzes prägen die Rolle des Beraters, die jedoch gleichzeitig spezifischen Risiken ausgesetzt ist, die aus der Interaktion mit dem Klientensystem erwachsen.
Organisationsberater bewegen sich in einem komplexen Spannungsfeld. Sie agieren zwischen unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Erwartungen und Funktionen und sind gleichzeitig dem ständigen Risiko ausgesetzt, von der Logik des Klientensystems vereinnahmt zu werden und dadurch ihre Wirksamkeit zu verlieren.
Grundsätzlich lassen sich zwei idealtypische Beratungsrollen unterscheiden: die Expertenberatung und die Prozessberatung (Widmer, Zirkler). Während der Experte spezifisches Fachwissen liefert und konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet, moderiert und gestaltet der Prozessberater den Problemlösungs- und Veränderungsprozess des Klientensystems, um dessen eigene Lern- und Lösungsfähigkeit zu stärken.
In der Praxis existiert jedoch ein weitaus breiteres Spektrum an offiziellen und inoffiziellen Funktionen, die Beraterinnen und Berater für ihre Klienten erfüllen. Eine Auswahl basierend auf der Zusammenstellung von Sommerlatte (via Zirkler) verdeutlicht diese Vielfalt:
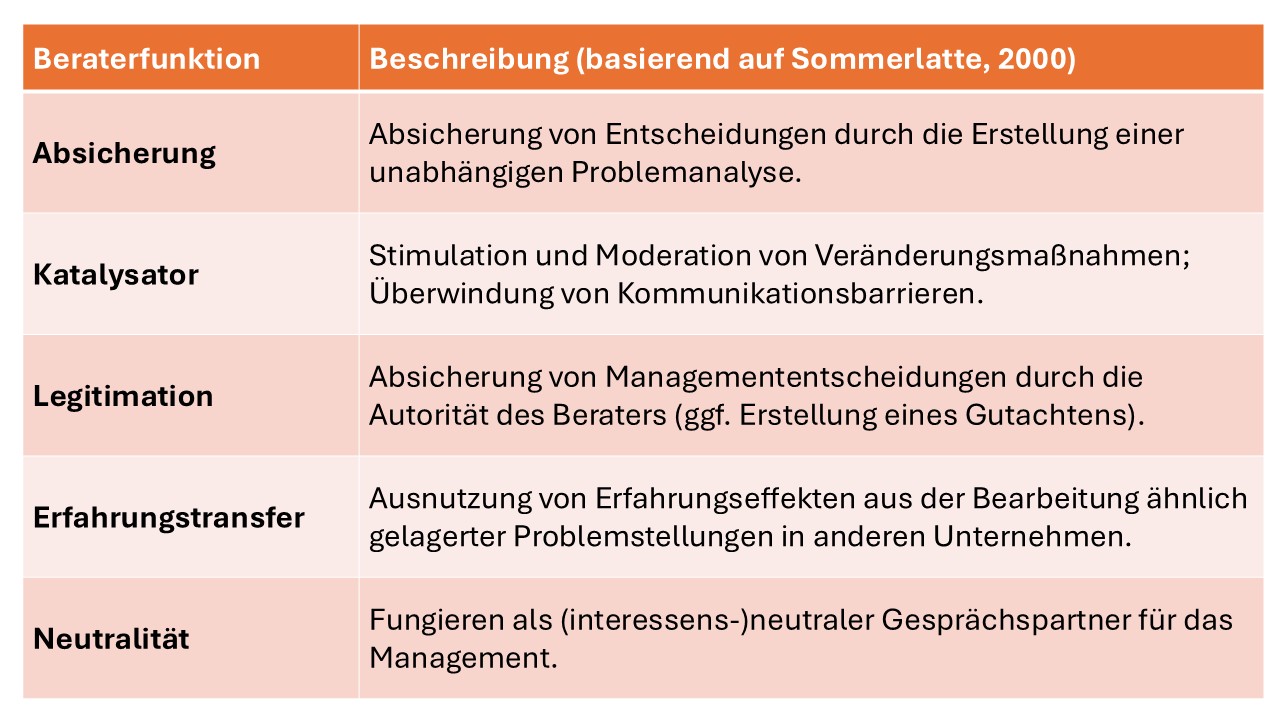
Eines der größten Risiken für die Wirksamkeit von Beratung ist der Mechanismus der Vereinnahmung oder Absorption durch das Klientensystem. Organisationen versuchen tendenziell, externe Impulse in ihre eigene Logik zu integrieren und zu neutralisieren. Der systemtheoretische Mechanismus dieser Vereinnahmung wurde von Susanne Mingers als Prozess "konfluierender Differenzen" beschrieben (vgl. Mingers 1996, in Zirkler 2005).
Dieser Mechanismus funktioniert wie folgt: Im Laufe eines Beratungsprozesses kann es zu einer zunehmenden Ähnlichkeit der Sichtweisen zwischen dem Berater- und dem Klientensystem kommen. Der Berater beginnt, die Welt mit den Augen des Klienten zu sehen, übernimmt dessen Annahmen und "blinde Flecken". Dadurch verschwimmt die notwendige Differenz zwischen der "fremden" Außensicht des Beraters und der "selbst"-verständlichen Innensicht der Organisation.
Die Konsequenzen dieses Absorptionsdrucks sind gravierend:
Der Berater verliert seine Fähigkeit zur Irritation, da seine Beobachtungen und Interventionen keinen Neuigkeitswert mehr für das System haben.
Seine Interventionen verlieren ihren Signalcharakter und werden zu einem bloßen Echo der internen Diskussionen.
Dies führt zu sogenannten "nicht-erfolgenden Interventionen": Obwohl der Berater formal interveniert, erzeugt seine Handlung keine wirksame Differenz mehr im System und verpufft wirkungslos (Mingers via Zirkler).
Um dem Absorptionsdruck entgegenzuwirken und die für wirksame Irritationen notwendige Differenz zum Klientensystem aufrechtzuerhalten, müssen Berater professionelle Gegenstrategien anwenden. Diese dienen der bewussten Gestaltung der eigenen Rolle und der Sicherung der professionellen Qualität.
Explizite Rollenklärung und -architektur: Eine der wichtigsten Aufgaben zu Beginn und im Verlauf eines Mandats ist das aktive Management der eigenen Rolle. Dies beinhaltet die klare Aushandlung von Erwartungen, die transparente Kommunikation der eigenen Vorgehensweise und die bewusste Einnahme einer Außenperspektive, um die notwendige Differenz zum Klientensystem zu wahren.
Zeitliche Befristung von Mandaten: Langfristige, unbefristete Mandate erhöhen das Risiko des "Hineinwachsens" in die Logik der Organisation. Eine klare zeitliche Begrenzung von Beratungsprojekten hilft, den Status als externer Impulsgeber zu bewahren und den Verlust der Irritationsfähigkeit zu verhindern.
Professionelle Supervision/Meta-Reflexion: Die regelmäßige Reflexion des Beratungsprozesses mit externen Dritten (Supervisoren, kollegiale Intervision) ist ein zentrales Instrument der Qualitätssicherung. Sie ermöglicht es, "blinde Flecken" in der eigenen Wahrnehmung, beginnende Konfluenz und die Übernahme von Systemlogiken zu erkennen und die professionelle Distanz aktiv wiederherzustellen.
Die bewusste Handhabung der eigenen Rolle und die kontinuierliche Selbstreflexion sind somit keine Kür, sondern eine professionelle Notwendigkeit, um die Wirksamkeit von Organisationsberatung nachhaltig zu sichern.
Die Analyse verdeutlicht, dass die Wirksamkeit in der Organisationsberatung fundamental probabilistisch und nicht deterministisch ist. Aufgrund der Eigendynamik und operationalen Geschlossenheit sozialer Systeme können externe Interventionen Veränderungen lediglich anregen oder deren Wahrscheinlichkeit erhöhen – sie können sie jedoch nicht garantieren oder kausal erzwingen (Bachmann & Loermann). Jede Intervention ist eine "Irritation", deren Verarbeitung von der internen Logik des Systems abhängt und daher prinzipiell unvorhersehbar bleibt.
Diese Erkenntnis hat eine zentrale Konsequenz für die Beratungspraxis: Wenn der Ausgang unsicher ist, muss die Qualität des Prozesses selbst in den Fokus rücken. Die Antwort auf die probabilistische Natur der Wirksamkeit liegt in einer konsequenten Professionalisierung des beraterischen Handelns. An die Stelle von Heilsversprechen und simplen Erfolgsrezepten tritt ein theoriegeleitetes, methodisch sauberes und selbstreflexives Vorgehen.
Eine solche professionelle systemische Beratungspraxis stützt sich auf drei zentrale Säulen:
Transparenz: Eine professionelle Haltung zeichnet sich durch die Offenlegung des eigenen Beratungskonzepts, der angewandten Theorien und der Grenzen der Machbarkeit aus. Klienten haben ein Anrecht darauf zu wissen, auf welcher Grundlage ein Berater arbeitet und was realistischerweise erwartet werden kann (Widmer).
Klare Rollenarchitektur: Die größte Gefahr für die Wirksamkeit ist die Vereinnahmung des Beraters durch das Klientensystem. Die bewusste Gestaltung der Berater-Klienten-Beziehung zur Sicherung der für wirksame Irritationen notwendigen Differenz ist daher keine Nebensache, sondern eine Kernkompetenz.
Strukturierte Selbstreflexion: Angesichts des Risikos, unbemerkt die "blinden Flecken" des Klientensystems zu übernehmen, ist die institutionalisierte Selbstreflexion durch Supervision oder Intervision ein unverzichtbarer Bestandteil der Qualitätssicherung. Sie ist das wichtigste Instrument, um die eigene Beobachtungs- und Irritationsfähigkeit langfristig zu erhalten.
Angesichts der inhärenten Unsicherheit organisatorischer Veränderungsprozesse ist es nicht allein der methodische Werkzeugkasten, der eine Beratung legitimiert. Vielmehr wird die Professionalität selbst – manifestiert in theoretischer Fundierung, transparenter Rollengestaltung und strukturierter Selbstreflexion – zur definierenden Eigenschaft einer verantwortungsvollen und verteidigungsfähigen Beratungspraxis. Sie ist die ethische und funktionale Antwort auf die Komplexität sozialer Systeme.
Organisationsentwicklung

Foto von Maria Thalassinou auf Unsplash
Fünf kontraintuitive, aber tiefgreifende Wahrheiten aus der Metatheorie der Veränderung
Von Marcus Winterfeldt
Veränderung ist die einzige Konstante im Geschäftsleben. Dennoch ist sie oft eine Quelle von Frustration und Misserfolg. Projekte werden mit großem Aufwand gestartet, nur um im Sande zu verlaufen oder auf unerwarteten Widerstand zu stoßen. Dieses Gefühl ist weit verbreitet und wird durch eine oft zitierte Behauptung untermauert: Bis zu 70 % aller geplanten Veränderungsinitiativen scheitern.
Der Grund für diese hohe Misserfolgsquote liegt oft tiefer als schlechte Planung oder mangelnde Kommunikation. Er liegt in einem fundamentalen Missverständnis darüber, was Veränderung im Kern eigentlich ist. Wir versuchen, etwas zu steuern, dessen grundlegende Dynamik wir übersehen. Dieser Artikel enthüllt fünf kontraintuitive, aber tiefgreifende Wahrheiten aus der Metatheorie der Veränderung, die Ihre Perspektive auf den Wandel für immer verändern können.
1. Stabilität ist das eigentliche Rätsel, nicht die Veränderung
Wir gehen meist davon aus, dass Veränderung der schwierige, aktive Prozess ist, während Stabilität der natürliche Ruhezustand ist. Die Systemtheorie dreht diese Annahme um: Systeme – ob Menschen, Teams oder ganze Organisationen – sind von Natur aus selbststabilisierend. Ihr Standardverhalten besteht darin, Prozesse zu wiederholen, um Beständigkeit zu erzeugen. Die eigentliche Frage lautet daher nicht: „Wie können wir uns verändern?“, sondern: „Wie schaffen es Systeme, so hartnäckig gleich zu bleiben und unerwünschte Zustände aufrechtzuerhalten?“
Aus dieser Perspektive wird die Rolle eines Beraters oder einer Führungskraft neu definiert. Wer seinen Job nur darin sieht, Veränderung von außen zu bewirken, hat die wichtigste Kraft im System – die Stabilität – übersehen.
Wer als Berater denkt, sein Job sei es Veränderung zu bewirken, ist zumindest einseitig, „vermutlich jedoch eher“ ungünstig konzeptionell unterwegs. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)
Die erste Frage in jeder Organisationsentwicklungsdebatte sollte daher nicht lauten: „Wie kommen wir nach X?“, sondern: „Welchen verborgenen, aber nützlichen Zweck erfüllt unser aktueller Zustand Y, und warum halten wir so hartnäckig daran fest?“ Und diese Dynamiken werden durch Entscheidungen aufrechterhalten. Doch unser Verständnis davon, was eine „Entscheidung“ überhaupt ist, ist oft genauso fehlerhaft.
2. Es gibt keine „richtigen“ Entscheidungen – nur Kompromisse
In der Geschäftswelt suchen wir ständig nach der „richtigen“ Entscheidung, der optimalen Lösung ohne Nachteile. Diese Suche ist oft vergeblich, weil sie auf einem Missverständnis beruht. Eine einfache Berechnung, bei der eine Option klar besser ist als die andere (wie „die Wahl zwischen einem Glas Sekt und einem Glas Rindergülle“ (aus Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)), ist keine echte Entscheidung. Eine wahre Entscheidung entsteht erst, wenn wir zwischen zwei ebenbürtigen Alternativen wählen müssen, bei denen wir nicht beides haben können.
Bei einer echten Entscheidung sind Gewinn und Verlust untrennbar miteinander verbunden. Wir gewinnen etwas, aber wir verlieren auch die Vorteile der nicht gewählten Alternative. Ein wesentliches Merkmal einer solchen Entscheidung ist daher die Möglichkeit des Bedauerns.
Ein System entscheidet immer dann, wenn es seine Wahl in seiner Zukunft auch bereuen könnte. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)
Diese Erkenntnis ist unglaublich befreiend. Anstatt nach der illusorischen „perfekten“ Lösung zu jagen, besteht die Aufgabe darin, den bestmöglichen Kompromiss zu finden und sich dann voll und ganz der Aufgabe zu widmen, dessen Nachteile aktiv zu managen. Doch während wir uns auf die Kompromisse sichtbarer Entscheidungen konzentrieren, übersehen wir oft die mächtigste Wahl von allen.
3. Die wichtigste Entscheidung ist die, die Du nie triffst
Jede Entscheidung, die wir treffen, basiert auf einer Reihe von Alternativen, die uns zur Verfügung stehen. Das Paradoxe daran ist: Bevor wir eine Alternative auswählen können, muss bereits eine Wahl getroffen worden sein, nämlich welche Alternativen überhaupt zur Wahl stehen. Diese grundlegende, oft unsichtbare Vorentscheidung ist die mächtigste von allen.
Ein einfaches Beispiel illustriert dies: Wenn Dir die Wahl zwischen „Bier oder Wein“ angeboten wird, ist die Möglichkeit „Sekt“ bereits ausgeschlossen, ohne dass es erwähnt wurde. Systeme (und Menschen) stabilisieren sich, indem sie das Menü der verfügbaren Optionen unbewusst einschränken. Der größte Hebel für Veränderung liegt darin, dieses unsichtbare Menü zu erweitern.
Beratung heißt also auch immer, die Menge und die Art der dem System zur Verfügung stehenden Alternativen zu erhöhen. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)
Die größten Durchbrüche entstehen nicht dadurch, dass man anders aus dem bestehenden Menü wählt, sondern dadurch, dass man das Menü selbst in Frage stellt. Anstatt zu fragen „Sollen wir A oder B tun?“, ist die mächtigste Frage, die eine Führungskraft stellen kann: „Welche Optionen sehen wir im Moment überhaupt nicht?“ Wenn wir dieses Menü erweitern und eine neue Alternative wählen, müssen wir uns gleichzeitig bewusst sein, dass jede neue Wahl unweigerlich einen Preis hat.
4. Jede Veränderung hat einen Schatten. Ignoriere ihn auf eigene Gefahr.
Jede Veränderungsinitiative, egal wie positiv sie formuliert ist, hat Kosten, Nachteile und eine „Schattenseite“. Der Versuch, diese negativen Aspekte zu ignorieren oder unter den Teppich zu kehren, ist einer der sichersten Wege, das Projekt zum Scheitern zu bringen. Damit eine Veränderung gelingen kann, muss ihre Schattenseite explizit anerkannt und bearbeitet werden.
Jede Absicht zur Veränderung erzeugt zwangsläufig einen inneren Konflikt im System. Es entsteht ein Pol, der die neue Zukunft anstrebt, und ein anderer Pol, der für den gegenwärtigen Zustand verantwortlich ist, sich damit identifiziert und keine Veränderung will. Dieser Konflikt ist nicht nur normal, er ist unvermeidbar. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)
Die Beschäftigung mit der Schattenseite, den Kosten, den Nachteilen der Veränderung gehört für ein Gelingen derselben unbedingt dazu, sonst droht der Prozess zu eindeutig (und damit unglaubwürdig, weil nichts ist vollkommen richtig) ... zu sein. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)
Hör auf, Veränderung als reines Positivprojekt zu verkaufen. Die ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was verloren geht, ist keine Schwäche, sondern die stärkste Strategie, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Widerstand von einer Bedrohung in eine produktive Kraft zu verwandeln. Die ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Schatten ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die Veränderung nicht nur ein kurzlebiges Projekt bleibt, sondern zu etwas Dauerhaftem wird.
5. Das Ziel ist nicht der Wandel, sondern die neue Normalität
Wir neigen dazu, den Erfolg einer Veränderung am Projektabschluss zu messen: Das neue IT-System ist implementiert, der neue Prozess ist dokumentiert, die Umstrukturierung ist verkündet. Doch das ist nur das spezifische Ergebnis. Der eigentliche Erfolg, der dauerhafte Nutzen, ist etwas ganz anderes: die Etablierung einer neuen Normalität.
Die neue Normalität ist der Zustand, in dem das neue Verhalten oder der neue Prozess zu einem unbewussten, fest verankerten Teil der Kultur geworden ist. Es ist der Punkt, an dem die bewusste Anstrengung des „Sich-Veränderns“ nicht mehr nötig ist, weil die neue Art zu arbeiten zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden ist. Es ist der Moment, in dem die neue Kultur institutionalisiert ist.
Hör auf, den Projektabschluss zu feiern. Der wahre Meilenstein ist der Moment, in dem Dein Team vergisst, dass es jemals anders war. Erkenne und belohne diesen Punkt, nicht die Vollendung des Projektplans.
Diese fünf Wahrheiten zeichnen ein alternatives Bild von Veränderung. Wir erkennen, dass der Fokus auf Stabilität (1) uns zwingt, die wahre Natur von Entscheidungen (2) als Kompromisse zu verstehen. Diese Erkenntnis lenkt unseren Blick auf die unsichtbaren Vorentscheidungen (3), die unser Handeln viel stärker prägen als die sichtbaren. Wenn wir es wagen, diese Vorentscheidungen zu ändern und eine neue Wahl zu treffen, müssen wir deren Schattenseite (4) bewusst anerkennen und gestalten. Nur so kann aus einem aktiven, anstrengenden Veränderungsprojekt eine unbewusste, stabile und neue Normalität (5) erwachsen. Es geht weniger darum, etwas Neues zu erzwingen, als vielmehr darum, die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich eine neue, bessere Form der Stabilität von selbst entwickeln kann.
Stell Dir also die entscheidende Frage, die hinter all diesen Einsichten steckt: Was ist die eine, unsichtbare Alternative, die Dein Team im Moment übersieht?
Lust auf vertiefende Theorie? Hier und hier findest Du einen Einstieg.
Leadership

Kristina Santl
Warum Festhalten einfacher ist, als Loslassen, oder?
Von Kristina Santl
Habt ihr euch schon einmal ganz krampfhaft an etwas festgehalten? Zum Beispiel früher als Kind, im Sportunterricht an diesen Seilen beim Turnen. Die über dicken Turnmatten hingen und das Ziel war, möglichst hoch zu kommen?
Ich war immer schon umgangssprachlich ein "Lauch" was die Kraft in meinen Armen betraf - typisch Mädchen, um im Stereotyp zu bleiben. Und ich konnte mich dort wirklich nie lange halten, geschweige denn sehr hoch klettern. Natürlich habe ich es versucht. Und beim "Weg nach unten", war ich auch eher Marke "Angsthase". Einfach runter springen und auf die Matte fallen lassen? Da war ich schon als Kind die, die sich die wildesten Knochenbruchszenarien ausmalte. Sprich, ich musste dort immer langsam runter. Bedeutet: Festhalten. Und am Ende Schwielen an den Fingern und 3 Tage Schmerzen in den Armen.
Bis ich es einmal probiert habe. Motiviert von einem sehr freundlichen Sportlehrer und ein paar netten Freunden. Probiere es doch mal! Von der Höhe kannst du springen. Dir passiert nichts. Das macht Spaß. Augen zu und loslassen. Passiert ist mir nichts und die 3 Tage Schmerzen blieben ebenso aus, wie die sich langsam abschälenden Hautpartien.
Die Moral von der Geschichte? Loslassen hat mir Schmerz und Verletzung erspart und meine Besorgnis über das nicht eintretende Ergebnis eines komplett weich gepolsterten Falls war vollkommen unberechtigt und nur in meinem Kopf.
Schöne Geschichte und warum erzählt sie uns das jetzt? Und vor allem in einem Blog über Organisations- und Führungskräfteentwicklung? Weil es zu dem passt, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe. In den unterschiedlichsten Ausprägungen.
Um wieder bildlich zu sprechen, gehe ich durch eine Turnhalle voller Kletterseile mit daran klammernden Führungskräften. Und die Fantasien dieser Führungskräfte übersteigen meine Knochenbruchzukunft noch um ein Vielfaches. Liegen dort unten nicht die Gefahren des "wir verlieren unsere Kunden"; "die Mitarbeiter sind dann alle unzufrieden"; "der Vorstand möchte das so nicht haben"; "darüber müssen wir mit dem Betriebsrat diskutieren"; "damit sind die Mitarbeiter noch völlig überfordert" und so weiter und sofort. Die Liste der Gefahren in dieser Unternehmensturnhalle ist lang und keine Turnmatte weich und einladend genug.
So stehen wir sehr oft neben unseren Kunden, deren Finger schon bluten (Überarbeitung, Überforderung, Stress, Burn Out) und die an diesem rauen und unbequemen Seil, nur 10 Zentimeter über der weichen gepolsterten Matte hängen, und überlegen, mit welchen Interventionen wir "der liebe Sportlehrer" sein können, der ihnen die Hand reicht um sich zu trauen loszulassen.
Ja, natürlich überzeichne ich völlig - vielleicht ein bisschen provokativ. Aber, immer in dem vollen Wissen, dass alle meine Klientinnen immer und vollständig in der Lage sind, ihre Probleme ganz einfach zu lösen. Jeder von ihnen kann einfach loslassen und ist vollständig in der Lage, sich einfach in die weiche Matte fallen zu lassen.
Warum? Warum sind wir so gestrickt, lieber bis zur vollständigen Erschöpfung und bis zur Verletzung an etwas festzuhalten, anstatt "einfach" loszulassen.
Ist es die Angst vor Veränderung? Sicherlich manchmal. Wir begleiten Veränderungen in unserem Berufsleben. Täglich und mehrfach. Und sie werden immer noch mehr. Die Zyklen immer noch kleiner. Und manchmal habe ich den Eindruck, je kürzer die Zyklen werden, umso heftiger wird die Abwehr. Und ist das nicht etwas, was man von sich selbst auch kennt. Die Sehnsucht nach Stabilität und etwas "berechenbaren". Vor allem einem berechenbaren Umfeld? Menschen die man einschätzen kann. Die so "funktionieren" wie man es gerne hätte oder wie man es sich vorstellt?
Was macht Veränderung, anders sein, etwas anders machen so "unheimlich"? Woher kommt diese Prägung? Alles Fragen, die man natürlich aus der Vergangenheit, aus jeder eigenen Lebensgeschichte und aus jeglicher einschlägiger Literatur in großer Ausführung beantworten kann. Ich möchte es aber gar nicht beantworten. Viel lieber zum Nachdenken anregen. Auch dazu - wo lässt du nicht los? Was in deinem (Berufs-)Leben hältst du fest? Oder auch an wem? Was darf sich nicht ändern, nicht anders gemacht werden? Wir haben alle solche Themen. Seien es Menschen, Dinge, Prozesse, Situationen, Abläufe. An irgendwas halten wir fest. Und das oftmals bis zu dem Punkt, an dem es wirklich ungesund für uns und oft auch für die Beteiligten drum herum wird.
Es blockiert. Uns selbst und unsere Entwicklung. Im Unternehmenskontext im Repertoire einer Führungskraft auch oft eine ganze Unternehmensentwicklung. Beginnend im kleinen, im eigenen Team und auch darüber hinaus.
Ein auch viel zitierter Spruch in meinem bisherigen Berufsleben: "Der Fisch stinkt vom Kopf, positiv wie negativ". Auch wenn ich kein Fan davon bin, ausschließlich der einzelnen Führungskraft immer alles in die Schuhe zu schieben - nicht umsonst bin ich Systemikerin geworden - das etwas ist, wie es ist, hat immer mehr als nur einen Protagonisten oder Blickwinkel der zu betrachten ist.
Dennoch wird die Wirkung von Führungskräften (vor allem von ihnen selbst) oftmals nach wie vor unterschätzt. Führung wirkt immer. Und selbst die lockerste Führungskraft, die loslassen kann und dem "Lassen" (zulassen, sein lassen, los lassen, geschehen lassen, entwickeln lassen etc.) in allen Formen mächtig ist, ist dennoch geprägt von ihren Co-Führungskräften und ihrer Führungskraft darüber (Systemikerin ;-)). Das bedeutet: ist im System eine stark genug wirkende Tendenz (entweder durch eine sehr hohe Position oder auch durch "die Mehrheit"), die Festhalten in Reinform praktikziert bis zum Exodus, dann wird das abfärben. Auf die ein oder andere Art. Es wird Auswirkungen haben auf diese des "Lassens" so mächtige Führungskraft. Und es entstehen Muster. Die sich auch immer wieder selbst erhalten, solange nicht genug Personen aus ihnen (den Mustern) aussteigen. Die Grundgesamtheit muss groß genug sein um wirkmächtig zu werden. Loslassen muss also das ganze System lernen - damit Muster unterbrochen werden. Denn natürlich hat das Festhalten, egal wie viel man "jammert" von allen Seiten, auch seine Vorteile - es fallen euch bestimmt welche ein wenn ihr ehrlich zu euch seid.
Den Prozess des Loslassens zu begleiten, ist ein Geschenk. Lehrt er einem doch immer auch wieder, wo man selbst noch festhält. Erkennt man doch auch immer wieder einen Teil seiner selbst in allem, denn man kann ja auch nur das beobachten, was man selbst auch (zum Teil) ist (oder war).
Was bedeutet Loslassen in deiner Organisation? Wo klammern sich Teams an alte Prozesse, überholte Rollen oder liebgewonnene Sicherheiten? Wo tust du es selbst?
Lust, gemeinsam den Mut-Muskel fürs Loslassen zu trainieren? Wir begleiten Organisationen dabei, den Sprung auf die Matte zu wagen – mit System, Erfahrung und einem klaren Blick von außen. Schreib mir und wir verabreden und für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Leadership
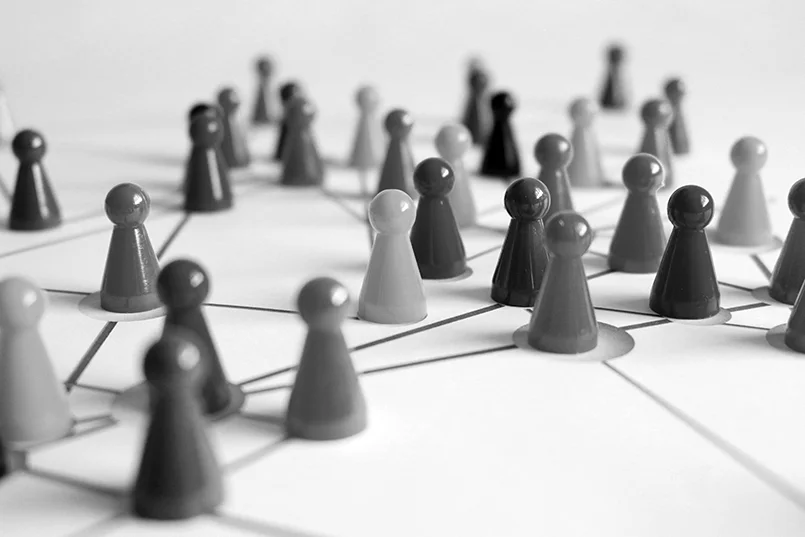
pixabay
„Mitarbeiter verlassen Führungskräfte und nicht Unternehmen.“ – Ist die Führungskraft als Person wirklich der Antiheld in der Geschichte von Unternehmen?
Von Kristina Santl
Ein gern zitierter Satz, nicht nur in der Literatur oder gar der Lehre über Human Resources, Unternehmen oder sogar Führung an sich, sondern auch im persönlichen Gespräch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ein wiederkehrendes Phänomen: „Mein Chef ist furchtbar“; „Ich halte es mit meiner Vorgesetzten nicht mehr aus – die muss weg oder ich gehe“. Will heißen: Die Person, die mich führt ist „schlecht, ungeeignet, unpassend, macht etwas nicht richtig“. Wer von uns hat das nicht schon gehört oder vielleicht sogar selbst gesagt oder erlebt?
Setzt man sich in Runden oberer Führungskreise, begegnet einem häufig ein sehr ähnliches Weltbild. Die Zahlen stimmen nicht? – Die Führungskraft kann mit dem Budget nicht umgehen. Die Mitarbeiter sind unzufrieden? – Die Führungskraft führt nicht gut genug. Um diesen oder ähnlichen negativen Fragestellungen entgegen zu wirken, werden in vielen Fällen die Personen durch langwierige Ausbildungspläne oder „Verhaltenstrainings“ gejagt und bei fortgesetzten „Versagen“ dann doch ausgetauscht. Sei es entlassen, weggelobt oder manchmal auch degradiert. Und dann eine neue Führungsperson gefunden – die wird es richten. Der heilige Gral „der passenden Person“ ist überall noch sehr tief verankert, ich nehme mich selbst von diesem Weltbild nicht aus. Auch verständlich, weil es das für alle einfacher macht. Man hat einen Sündenbock gefunden an dem das Missfallen fest gemacht werden kann. Der Bösewicht der Geschichte ist gefunden und das Elixier der Lösung steht schon parat: der Austausch oder die Veränderung dieser einen Person und deren Denken, Handeln und Verhaltensweisen. Danach ist dann bestimmt alles besser – Problem erledigt.
Und das „böse Erwachen“ lässt nicht lange auf sich warten: Wie oft haben wir schon erlebt, dass weder ein ausgeklügeltes Schulungskonzept noch ein Austausch von Personen, das Allerheilmittel ist? Oder hat es bei dir im Unternehmen immer funktioniert, dass die Welt eine bessere wurde durch eine Neubesetzung? Oder hast du nach einem neuen Ausbildungskonzept nicht auch schon mal erlebt, dass vielleicht sogar die Passung und Zufriedenheit scheinbar noch mehr ins Negative verrutscht sind? Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man dieses Phänomen vielleicht sogar nicht nur im Zusammenhang mit Unternehmen beobachten, sondern auch in eher privaten Umfeldern? Es gibt Situationen, da ändert sich einfach nichts am großen Ganzen – an den Zahlen, an der Zufriedenheit, am Erfolg – wenn Einzelpersonen „bearbeitet“ oder ausgewechselt werden. Aber was bedeutet das dann jetzt? Was kann man denn nun tun, wenn im Unternehmen die Zahlen ins Negative laufen, Mitarbeiter unzufrieden sind und vielleicht sogar ganz explizit die Beschwerden an der Führung laut werden? Wenn der Erfolg einer Führungskraft und ihrer Einheit nicht mehr allein an den Eigenschaften des entsprechenden Individuums hängt, was ist dann Führung eigentlich genau?
In der systemischen Betrachtungsweise von Organisationen erschließt sich die Fehlallokation, in die wir laufen, wenn wir aus Gründen der Komplexitätsreduktion das Thema „Führung“ ausschließlich auf ein Individuum abwälzen. Natürlich, und da sind sich auch alle lauten und leisen Kritiker an der personenzentrierten Betrachtungsweise einig, wäre es ebenso zu kurz gedacht, die Person, die eben in der Führungsrolle steckt, vollkommen von der Leine zu lassen. Vielmehr macht es Sinn, Führung größer zu fassen und um andere Komponenten zu erweitern – eben nicht die Augen vor der Komplexität zu verschließen und Kausalzusammenhänge zu unterstellen, die es nicht gibt.
Die Frage, die wir uns stellen sollten ist also: „Was ist erfolgreiche Führung“ anstelle von „Was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus?“ (vgl. Sprenger S. 40 – Radikal führen). Führungskräfte stehen nicht als einzelnes Individuum, das frei über Erfolg- oder Misserfolg selbst „entscheiden“ und diesen aus sich heraus selbst beeinflussen kann, sondern bewegen sich innerhalb der Wechselwirksamkeit zwischen den Personen in ihrer Einheit und des Unternehmens – ihr eigenes Verhalten wird somit zirkulär von dem anderer beeinflusst und ist nicht einheitlich vorherzusagen („Die Person ist doch normalerweise immer so und so“) und sie bewegen sich innerhalb des institutionellen Rahmens, den ihnen ihre eigene Organisation steckt. Die Systemtheorie besagt, dass Menschen nicht nur agieren, sondern auch ganz wesentlich reagieren und richtet somit das Augenmerk nicht allein auf die Person als Individuum, sondern auf das, WAS zwischen Personen als Interaktion und Kommunikation stattfindet. Führungskräfte haben in Unternehmen zwar die „Macht“, innerhalb ihrer Rahmenlinien Entscheidungen zu treffen, doch diese sind durch zahlreiche Vorentscheidungen geprägt, welche durch Arbeitsprozesse und Vorgehensweisen sowie Regeln innerhalb des Unternehmens vorgegeben sind. Diese Strukturen, um Sprenger zu zitieren, „können so mächtig sein, dass die Bemühungen einer einzelnen Führungskraft nahezu aussichtslos machen. Gleichgültig, wie sie denkt und handelt, gleichgültig welches Ziel sie sich vornimmt und wie sehr sie sich Mühe gibt: Die Prozesse bestimmen das Resultat.“ Nimmt man sich diese Betrachtungsweise zur Brust, kommt man nicht umhin, der Erkenntnis offen zu sein, dass nicht nur die Führungskraft ein exzellentes Umfeld erschafft, sondern eben auch ganz wesentlich das Umfeld veränderungsbereit und passend sein muss, damit eine Person, ganz egal wie ideal diese in ihren Eigenschaften ist oder nicht, glänzen kann.
Möchte man somit als UnternehmerIn Führung im eigenen Unternehmen beeinflussen, wäre es nach dem systemischen Ansatz sinnvoll, dies als Symphonie aus Strukturen, Instrumenten und Organisationsentscheidungen mit der individuellen Passung einer Person auf dieses gegebene Umfeld zu begleiten. „[…] Führung findet also statt sowohl aktiv durch Menschen, als auch passiv durch Strukturen (die wiederum aktiv von Menschen gestaltet wurden und werden). […] Führung ist die Gesamtheit der Führungs-Kommunikationen, nicht nur der Menschen“ (Sprenger, S. 42).
Führung in einem Unternehmen besteht somit also aus der Fähigkeit eines Systems, die gelebten gegenwärtigen Praktiken auf zukünftige Anforderungen hin zu reflektieren und kontrollieren, und eben Anpassungen vorzunehmen. Die Führung wird im Unternehmen somit, abseits von der reinen Personenbrille, zum Supervisor des eigenen Systems, dessen Erfolg davon abhängt, ob die Erkenntnisse der Prüfung auch zu relevanten Veränderungen innerhalb des Unternehmens und somit einer möglichen Verbesserung führt.
Das bedeutet für die Praxis: Trau dich, alte Denkweisen zu überwerfen und in deinem Unternehmen Führungsfunktion und Führungsperson als wechselseitige Einflussnehmer anzuerkennen und Führung nicht mehr allein in den Eigenschaften einer Person, sondern in den Kommunikations- und Handlungsmustern zu messen, innerhalb derer diese sich bewegt und agiert. Beleuchte dein Führungssystem aus einem neuen Blickwinkel.
Leadership

pixabay on pexels
Über Leadership, Wölfe, Einsamkeit und der Suche nach einem Zusammenhang.
Von Kristina Santl
Führung wird oft mit dem „Leittier an der Spitze“ gleichgesetzt. Der einsame Wolf, der Herdenführer, der weiß wo es lang geht. Doch wie ist das wirklich? Was ist dran an diesem Vergleich?
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ein tatsächliches Arbeiten nach diesem Gleichnis auf Dauer nicht funktioniert. Ich habe inzwischen genug Führungskräfte im nahen und fernen Umfeld erlebt, deren Teams entweder ständig zerfallen sind, weil sie unter so einem „Diktator“ nicht weiterarbeiten wollten, oder aber „auf Durchzug“ geschalten und nur noch Dienst nach Vorschrift machen. In beiden Fällen tritt man eher auf der Stelle mit seiner Abteilung. Denn Innovation und Schaffenskraft entstehen dann, wenn eine Gruppe sich vertraut und das wiederum entsteht erst dann wirklich, wenn man sich kennenlernt. Und kennenlernen kann man sich nur, wenn man sich eine gewisse Zeit hinweg aufeinander einlässt.
Und trotzdem, ein bisschen was ist schon dran an diesem Spruch. Und ich glaube, dass ist eine Lernerfahrung, die eine Führungskraft machen muss und dies auch idealerweise bewusst tun sollte. Denn ganz egal wie nah man seinem Team eigentlich ist und wie intensiv das Vertrauensverhältnis und die Zusammenarbeit, Schulterklappen in einem klassischen deutschen Unternehmen bedeuten immer noch, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen treffen zu müssen, die vielleicht nicht allen gefallen, Dinge zu wissen die man erstmal einfach nicht erzählen kann und darf weil man sich an Regeln zu halten hat.
Wirkliches Leadership bedeutet die Fähigkeit, eine Gruppe von Menschen dazu zu befähigen ihre fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in sich selbst zu entdecken und diese für sich, für die Gruppe und für die Vision des Unternehmens zielführend einzusetzen. Dabei Freude und Begeisterung zu wecken und unterschiedliche Charaktere so zu vereinen, dass ihr auftretenden Reibungsflächen in vorwärtsgerichtete Lösungsorientierung münden. Ich höre schon den ein oder anderen sagen: Ja genau. Aus welchem Psychologie – Wunschtraum – Ratgeber hat sie das denn abgeschrieben. Mir ist, aus eigener Erfahrung, absolut klar, dass das fast schon eine Lebensaufgabe ist. Weil es voraussetzt, an sich selbst zu arbeiten. In diese Definition scheint jetzt das Bildnis des einsamen Wolfes so überhaupt nicht rein zu passen. Und doch glaube ich, dass man diesen in sich selbst irgendwann entdecken muss um, umfassend genau zu dem oben beschriebenen Leader werden zu können.
Man kann eine Gruppe von Menschen nur dann vereinen, wenn man sich seiner selbst bewusst ist. Das bedeutet aus meiner Sicht auch, sich einmal bewusst von der Gruppe abzugrenzen. Eine nahe und zugewandte Führungskraft zu sein bedeutet trotzdem, sich abgrenzen zu können. Eigene Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken bewusst wahrzunehmen, diese dem Team auch mitzuteilen und dabei auch zulassen zu können, dass andere Meinungen bestehen und gegebenenfalls diese auch durchgesetzt werden. Denn ganz entgegen dem klassischen Gedanken des einsamen Wolfes, der seine Richtung durchsetzt verstehe ich es so, dass die Kunst darin besteht eben erst recht andere Meinungen, Ansichten und Vorschläge neben seinem eigenen bestehen lassen zu können und diese auch anzunehmen. Man muss kein „karrieregeiler“ Egoist sein damit einem das schwer fällt. Ich als Person neige zum Beispiel eher dazu, zu viel beschützen zu wollen und andererseits „gemocht zu werden“. Das bedeutet, wenn ich auf meiner Meinung beharre dann eher aus Angst und wenn ich einknicke, dann aus meinem Bedürfnis heraus zu hören „stimmt du hast recht“.
Eine meiner wertvollsten Erfahrungen mit meinem Team, war ein Meeting zur Reorganisation im Haus. Wir wollten ausplanen, wie wir als Gruppe damit umgehen und welche Auswirkungen es auf unsere Aufteilung und Prozesse haben sollte. Der Vorschlag, den ich in diesem Meeting zur Diskussion stellte, hätte eine große Umorganisation im Team bedeutet. Und es war ganz klar, dass nicht alle davon begeistert sein würden. Ich spürte das Aufflackern meiner oben genannten Persönlichkeitseigenschaften und entschied mich bewusst mit diesen zu arbeiten. Das Ergebnis daraus, war eines der fruchtbarsten und gelöstesten Teammeetings, was wir seit langem hatten. Es wurde nicht meine Lösung. Wir fanden eine bessere. Eine, mit dem das Team gut leben und arbeiten kann. Es war eines der offensten Gespräche der Gruppe, in der jeder seine Herausforderungen, Sorgen oder auch Ängste darlegte und wir uns gegenseitig alle einen großen Schritt näherkamen. Einfach dadurch, weil eingangs ich und dann auch alle anderen sich selbst anerkannten und auch offen darstellten. Jede Person als Individuum anzuerkennen und zu erkennen half dabei, dass die Gruppe miteinander schwingen konnte.
Das mag jetzt klingen wie eine Kleinigkeit, doch für mich bedeutete es eine sehr wichtige Erkenntnis. Einsamer Wolf ja – im Sinne von ich lasse los und lasse zu. Ich bringe meine Ideen und Vorstellungen ein, die aus meinem (oft auch einseitigen) Wissen über Ereignisse innerhalb des Unternehmens geprägt sind. Ich kann dadurch Impulse geben und durch gezieltes Fragen und Leiten des Termins, dem Team die Möglichkeit geben eine für alle passende Lösung zu erarbeiten. Damit verteile ich Last von meiner Schulter auf mehrere ohne die Zügel aus der Hand zu geben, ich habe ein glückliches Team, ich kann maximal transparent sein denn durch Offenheit erzeuge ich Verständnis. Und was das Wichtigste ist – ein Wolf ist ein Rudeltier und ein Rudel funktioniert nur gemeinsam. Das alte Bild des starken diktatorischen Leittiers ist längst überholt. Gemeinsam ist man stark.
Organisationsentwicklung

JESHOOTS.COM on Unsplash
5 Gründe, warum in Unternehmen die Strategieumsetzung fehlschlägt
Von Marcus Winterfeldt
Wir sind uns einig, dass für wirksame Strategieumsetzung Kommunikation eine hohe Bedeutung hat. Überspitzt gesagt: wenn Führungskräfte die Kommunikation der neuen Unternehmensstrategie meistern, wäre die Neuausrichtung der Mitarbeiter sicher und widerstandslos überwunden. Diverse empirische Forschungen in den letzten Jahrzehnten belegen jedoch das Gegenteil. Es wurde wiederholt gezeigt, dass 50 – 70 Prozent aller Veränderungsvorhaben hinter den gewünschten Ergebnissen zurückbleiben.
Unmengen von „Slides“ zur Strategie sind schnell gemalt und verbreitet, jedoch die Umsetzung in echte unternehmerische Wertschöpfung ist eine Kunst. Jeder weiß, Strategieumsetzung ist dann Führungsaufgabe, wenn die Leistung durch die strategische Initiative verbessert werden soll.
Wir sind uns einig, dass für wirksame Strategieumsetzung Kommunikation eine hohe Bedeutung hat. Überspitzt gesagt: wenn Führungskräfte die Kommunikation der neuen Unternehmensstrategie meistern, wäre die Neuausrichtung der Mitarbeiter sicher und widerstandslos überwunden. Diverse empirische Forschungen in den letzten Jahrzehnten belegen jedoch das Gegenteil. Es wurde wiederholt gezeigt, dass 50 – 70 Prozent aller Veränderungsvorhaben hinter den gewünschten Ergebnissen zurückbleiben und finanzielle Verluste hinterlassen.
Natürlich sind klare und konsistente Botschaften wichtig. Wie werden aber (frei nach Drucker “Culture eats strategy for breakfast”) mächtige, unausgesprochene Botschaften innerhalb der Organisationskultur berücksichtigt, die der offiziellen Rhetorik widersprechen? Welche Führungskräfte kennst du, die sich bei der Strategieumsetzung mit Emotionen in ihrem Verantwortungsbereich befassen? Welche Rolle spielen kollektive Emotionen, d. h. Emotionen die von Stakeholdergruppen innerhalb (z. B. Mitarbeiter) und außerhalb (Kunden oder Investoren) der Organisation erlebt werden?
Drucker konsequent weiter gedacht bedeutet: der Erfolg der Führungskräfte zur Umsetzung ihrer Strategie ist von der emotionalen Treue der Stakeholder abhängig. Was erlebe ich jedoch in der Praxis: Führungskräfte konzentrieren sich bei Umsetzungsaktivitäten und Kommunikation auf die Ratio entlang von Zahlen, Daten, Fakten und vernachlässigen Emotionen. Drucker legt jedoch Nahe, dass für subtile, non-verbale Zeichen kollektiver Emotionen empfängliche Führungskräfte glaubwürdiger hinsichtlich der Führung strategischer Veränderung sind als andere.
Klingt theoretisch, ist es auch. Deswegen ein Beispiel aus dem Führungsalltag: mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du Teil des Problems, wenn du in deinem Verantwortungsbereich einen Verdrängungswettbewerb bei der Leistungsbeurteilung führst und Mitarbeiterleistung in eine Rangfolge zu bringen versuchst. Unabhängig von der individuellen Leistung wird dabei ein gewisser Prozentsatz von Mitarbeitern immer als „unterdurchschnittlich“ oder „schlecht“ eingestuft. Angestellte mit niedrigem Rang werden dann nicht für Förderungen und Lohnerhöhungen vorgesehen und manchmal sogar entlassen. In einer solchen Umgebung werden deine Mitarbeiter vorsichtig im Wettbewerb untereinander. Jeder versucht sich mit Mitarbeitern zu umgeben, die ihn im Vergleich besser aussehen lassen. Wenn du das machst oder gut findest, ist dein Führungsstil sehr wahrscheinlich von wenig emotionaler Bindung geprägt.
Wissenschaftler haben die fünf emotionalen Barrieren für die Umsetzung einer Strategie in Organisationen identifiziert. Jede für sich bedroht den Erfolg deiner Transformation, indem sie das Gefühl der Dringlichkeit, das Engagement für und das Einlassen auf eine gemeinsame Aufgabe verhindert:
Misstrauen und mangelnder Austausch von nützlichen und zeitkritischen Informationen
Eine politisch geprägte Mentalität, die die Sichtbarkeit im Management vor eigene Aktivität priorisiert. Dies führt dazu, dass niemand der Bote schlechter Nachrichten sein will. Auf Probleme wirst Du nur dann aufmerksam (machen), wenn es zu spät ist. Die strategische Ausrichtung wird durch das Horten von Information zwischen den Spielern. Führungskräfte sehen ihre Kollegen als Konkurrenten.
Geringe Empfänglichkeit für Veränderungen
Selbst offensichtlich und nützliche Veränderungen sind einfach zu erklären, aber schwierig umzusetzen. Du musst deinen eigenen Willen und die Fähigkeit zur Veränderung beweisen, bevor Du andere darum bittest.
Reden und unabgestimmtes Handeln
Du musst deine Mitarbeiter in Richtig eines gemeinsamen Ziels begeistern. Ansonsten werden Teams tendenziell in unterschiedliche Richtungen abdriften und zu Silos. Die Silos wieder zu integrieren ist aufwändig und dauert.
Mechanisches Handeln
entsteht, wenn Du nichts dagegen tust, dass deine Mitarbeiter unter hohem Zeit- und Leistungsdruck zu Gewohnheitstieren werden anstatt den Versuch zu wagen, innovativ zu sein.
Selbstzufriedenheit
Angesichts der zu erwartenden Anstrengung und des Risikos des Scheiterns eines strategischen Wandels, glaubt die Organisation als Ganzes, dass der Status quo gut genug ist, warum also die harte Arbeit auf sich nehmen?
Dein Schlüssel zum Erfolg: Verbringe deine Zeit damit, die passende Balance zwischen Ratio und Emotion zu finden. Wende für die Ratio (solide Strategieentwicklung) soviel Zeit und Energie wie nötig und so wenig wie möglich auf. Sei gleichermaßen bestrebt, dich emotional zu engagieren. Damit investierst du eine Kultur, die den Geist der Veränderung schnell aufblühen und die erfolgreiche Strategieumsetzung forcieren wird.
Organisationsentwicklung

Andrea Piacquadio von Pexels
Ist kollegial-selbstorganisierte Führung ein hilfreiches Modell?
Von Marcus Winterfeldt
Im Zeitalter des Internet ist es viel einfacher geworden, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Diese neuen Geschäftsmodelle sorgen für eine große Dynamik und Komplexität in bestehenden Unternehmen, weil diese sich anpassen und neu erfinden müssen. Für einen dynamischen und komplexen Kontext ist schwer vorhersehbar, wann und wo in der Organisation welche Kooperationen notwendig sind. Deswegen müssen Verantwortung, Führung, Entscheidung und Kooperationen situativ gestaltet werden.
Organisationsentwicklung kennt jeder. Gabler definiert dazu „Strategie des geplanten und systematischen Wandels, der durch die Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und individuellem Verhalten zustande kommt, und zwar unter größtmöglicher Beteiligung der betroffenen Arbeitnehmer.“ Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Mal davon abgesehen, dass wohl niemand gern ein „Betroffener“ ist. Wie passt denn jetzt noch agil dazu? Eine Definition liefern Oestereich und Schröder: „Agile Organisationsentwicklung ist die schrittweise pragmatische Weiterentwicklung einer Organisation durch kontinuierliche praktische Erprobungen einzelner Veränderungen mit anschließender Nutzenbewertung und Fortführungsentscheidung mit kollegial-selbstorganisierten Führungsprinzipien.“ Kollegial-selbstorganisierte Führung. Wie soll das den bitte gehen?
Was die Wirtschaftsgeschichte lehrt und wohl immer wichtig bleiben wird sind Effizienz und Produktivität. Zunächst ging es im Taylorismus um Standardisierung, später kamen Automatisierung, EDV und Roboterisierung dazu und seit ein paar Jahren bestimmt die Digitalisierung das Wirtschaftsleben. Das Besondere ist, dass Produktivitätssteigerungen früher mit Kapital erkauft wurden, aber heute die Grenzkosten bei der Digitalisierung gegen Null laufen. Sobald die Digitalisierung greift, müssen Gewinne nicht mehr für Produktivitätssteigerungen verwendet werden, sondern die Unternehmen bekommen diese dank vernachlässigbarer Grenzkosten quasi „geschenkt“.
Im Zeitalter der Digitalisierung geht es also um die bessere Nutzung der Null-Grenzkostenbereiche in den Geschäftsmodellen der Unternehmen und damit um die stetige Erfindung neuer Kundenbedürfnisse. Hier entsteht eine zusätzliche Herausforderung für Unternehmen, nämlich die eigene Anpassungsfähigkeit systematisch zu erhöhen.
Wir sind uns einig: im Zeitalter des Internet ist es viel einfacher geworden, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Im Erfolgsfall geht das sogar soweit, dass ganze Geschäftsmodelle oder Branchen in Frage gestellt werden (meine Lieblingsbeispiele, wie immer: airbnb, uber, netflix, amazon, zalando usw.). Diese neuen Geschäftsmodelle sorgen für eine große Dynamik und Komplexität in bestehenden Unternehmen, weil diese sich anpassen und neu erfinden müssen. Für einen dynamischen und komplexen Kontext ist schwer vorhersehbar, wann und wo in der Organisation welche Kooperationen notwendig sind. Deswegen müssen Verantwortung, Führung, Entscheidung und Kooperationen situativ gestaltet werden. Und hier finden wir jetzt die Ergänzung der Organisationsentwicklung um einen variierenden kontextspezifischen Führungsfokus.
D. h. in Organisationen existieren verschiedene Führungskontexte nebeneinander, nur dass in verschiedenen Organisationsteilen und zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils ein anderer Fokus relevant ist.
Je weiter der Fokus in der Komplexitätsmatrix unten links liegt, desto eher überwiegen die Vorteile fester Führungskräfte, standardisierter, stabiler Prozesse und Strukturen, Erfahrungswissen und bekannte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge.
Je weiter der Fokus oben rechts liegt, desto wichtiger ist unmittelbare, dynamische Kooperation. Führung, Entscheidung und Kommunikation ist kollegial verteilt, d. h. das liegt dynamisch-selbstorganisiert bei vielen Kollegen.
Gehen wir also davon aus, dass etablierte Unternehmen (wie eingangs gezeigt) lernen müssen, mit Komplexität und Dynamik umzugehen. Dann scheint kollegiale Führung ein geeignetes Modell zu sein: in einem komplexen Kontext ist kaum vorhersehbar, wann wer mit wem worüber sprechen muss. Damit sind feste Führungs-, Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen überfordert. Zu viele Beteiligte mit der eingeschränkten Perspektive auf ihren Einflussbereich benötigen zu viel Zeit und liefern zu wenig belastbare Ergebnisse. Organisationen, die in kollegialer Führung geübt sind, können den passenden Führungsfokus schneller und wirksamer einnehmen als andere. Passende direkte Kommunikationen entstehen selbstverständlicher, routinierter und günstiger.
Deswegen ist kollegial-selbstorganisierte Führung im aktuellen wirtschaftlichen Kontext ein hilfreiches Modell. Oder? Was meinst Du? Schreib mir an. Ich freu mich über deine Nachricht.
Leadership

Becca Tapert on Unsplash
Mit gemeinsamen Rollenverständnis zu Transparenz und individuellen Gestaltungsspielraum
Von Kristina Santl und Marcus Winterfeldt
Grenzen im Sinne festgeschriebener Regularien und getakteter Kontrollen sind zu einseitig. Zielführender ist vielmehr, den Mitarbeitern in ihren Rollen und Funktionen größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu geben sowie die gemeinsame Zusammenarbeit zu vereinbaren. Kristina greift im Sinne situativer Führung heute in das operative Geschäft nur dann ein, wenn die Mitarbeiter sie zu Rate ziehen oder aus systemischer Sicht eine Intervention notwendig wird.
Unsere Sicht auf erfolgreiches agiles Arbeiten im Team haben wir bereits in einem Beitrag geteilt: der Fokus sollte auf Sinnstiftung, Aufmerksamkeit und Freiheit liegen.
Eine für uns erstaunliche Erkenntnis im Rahmen der Analyse diverser Führungsrollen ist, dass Freiheit nur dort entstehen kann, wo Leitplanken und Grenzen allen transparent sind, sowie erwünscht und erlaubt ist, innerhalb dieser zu agieren.
Werfen wir einen Blick auf Kristinas Haltung als Führungskraft: „Zu Beginn meiner Führungsaufgabe wollte ich meinem Team vor allem freies und selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen, es in alle Entwicklungen der Abteilung mit einbeziehen und Einschränkungen vermeiden. Gerade um Zufriedenheit und ‚Harmonie‘ im Team sicherzustellen.
Ich stehe auch nach wie vor zu dem Grundsatz der Transparenz und Zusammenarbeit und dazu, dass gemeinsames Erarbeiten und Einbeziehen ein höheres persönliches Kommitment und bessere Leistungen erzielt. Meine Erkenntnis war dabei aber, dass Grenzen und Leitplanken in bestimmten Ausprägungen notwendig und sogar zwingend erforderlich sind, um Freiheit für mein Team zu gestalten und auch eine zufriedene und zugewandte Zusammenarbeit zu gewährleisten.“
Grenzen im Sinne festgeschriebener Regularien und getakteter Kontrollen sind dafür zu einseitig. Zielführender ist vielmehr, den Mitarbeitern in ihren Rollen und Funktionen größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu geben, sowie die gemeinsame Zusammenarbeit zu vereinbaren. Kristina greift im Sinne situativer Führung heute in das operative Geschäft nur dann ein, wenn die Mitarbeiter sie zu Rate ziehen, oder aus systemischer Sicht eine Intervention notwendig wird.
Strukturell besteht eine Organisation aus einer benötigten Anzahl von Rollen und darunter liegenden Positionen, die die für das Unternehmen zur Zweckerfüllung notwendigen Aufgaben ausführen. Für diese Rollen bringt jeder der Mitarbeiter sein eigenes Kompetenzspektrum und seine Persönlichkeitseigenschaften mit. Nur selten begegnen wir in der Praxis dabei einem Deckungsgrad zwischen Anforderungen der Rolle und Eigenschaften des Mitarbeiters von 100 Prozent. Das ist auch ganz im Sinne von Steve Jobs gar nicht notwendig: „Es macht keinen Sinn, kluge Köpfe einzustellen und ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben. Wir stellen kluge Köpfe ein, damit sie uns sagen, was wir tun können.“ Ein Mitarbeiter besteht aus viel mehr, als den Eigenschaften, die für die Ausführung seiner Rolle notwendig sind. Er hat übergreifend systemisch betrachtet, in den meisten Fällen, sogar mehrere Rollen gleichzeitig inne. In unterschiedlichen Kontexten – beruflich wie privat – werden jeweils andere Arten von Rollen eingenommen. Sich finden und auch identifizieren in seiner „Rolle“ ist dabei nur möglich, wenn man sich von dieser auch abgrenzen kann. Führungskräfte haben dafür die Erwartungen und Anforderungen nachvollziehbar und verständlich zu formulieren und den Mitarbeitern zu ermöglichen, sich im Rahmen ihrer Rolle und der „Spielregeln des Teams“ frei bewegen zu können. Das folgende Vorgehen unterstützt Führungskräfte dabei:
Definiere Rollen – Positionen – Aufgaben innerhalb deines Teams um den einzelnen Mitarbeitern und dem Gesamtteam die an sie gestellten Anforderungen und Erwartungen transparent zu machen;
Gleiche im Rahmen von Mitarbeitergesprächen die Rollenerfordernisse mit den Ressourcen und Kompetenzen ab und vereinbare gemeinsam einen Maßnahmenplan um Dissonanzen auszugleichen;
Gib deinem Team und dir die Möglichkeit, sich auch bewusst abzugrenzen: Wo beginnt z.B. die Rolle Teamleitung die du mit den Eigenschaften deiner Person füllst und wo ist die Grenze zu deiner Person;
Mach Abgrenzungen transparent um Entscheidungen zu verdeutlichen. Zum Beispiel: Meine Teamleitungsrolle erfordert bei XY folgende Entscheidung, persönlich verstehe ich deine Sicht, lass uns einen Konsens finden;
Ermögliche den Teammitgliedern, in ihren Rollen zu wachsen, diese mit zu gestalten und erarbeite durch systemische Fragestellungen mit ihnen Lösungen, die aus ihrem Kompetenzspektrum getragen werden können.
Lege mit deinem Team „Vereinbarungen der gemeinsamen Zusammenarbeit“ fest und schafft gemeinsam dasselbe Verständnis für Rollenfindung und -entwicklung, sowie Entscheidungsräume.
Leitplanken und „Grenzen“ schaffen heute in Kristinas Team nicht nur mehr Transparenz und Gestaltungsspielraum, sondern geben ihr als Führungskraft ebenso mehr Freiheiten für übergreifende Themen. „Loslassen“ wird durch das gemeinsame Verständnis um ein vielfaches leichter.
Leadership

Annika Treial on Unsplash
Was man als Führungskraft von Pferden erfahren kann
Von Kristina Santl
Pferde sind Herden- und Fluchttiere. Um zu überleben, zeichnet sich die Führungspersönlichkeit eines Pferdes durch Achtsamkeit, Erfahrung, Respekt und ständige Präsenz aus. Solange diese Kompetenz spürbar ist, wird die Führung durch die Herde akzeptiert. Pferde reagieren auf menschliche Ausstrahlung, insbesondere in Form von Gefühlen und Körpersprache, in gleicher Weise wie auf einen tierischen Partner. Somit geben sie durch ihr Verhalten ein klares, unmittelbares Feedback.
“Some horses will test you, some horses will teach you and some horses will bring out the best in you.”
Wie bewusst ist dir, welche Wirkung du auf dein Team hast? Wie nehmen dich deine Mitarbeiter wahr?
Als Führungskraft stehst du täglich zu 100 Prozent der Arbeitszeit im Fokus deiner Mitarbeiter. Du wirst von ihnen bewusst und unbewusst „gelesen“, sowohl verbal, als auch nonverbal. Gibt es dazwischen eine Diskrepanz, sprich wirkst du mit deinem Auftreten komplett gegensätzlich zum gesprochenen Wort, kommt es schnell zu Missverständnissen oder Konflikten. Echte Führung lässt sich zu 80 % an der Interaktion durch Körpersprache fest machen. So unterstützt eine gute Führungskraft ihre verbale Sprache durch eine authentische und kongruente Körpersprache. Ihr Körper signalisiert Dominanz, die Überzeugung, das Richtige zu tun sowie, dass sie bereit und fähig ist, ihre Mitarbeiter ernst zu nehmen und ihnen zu helfen. Gleichzeitig fordert sie nonverbal von diesen aber auch Respekt, Loyalität und Vertrauen ein. Schaffst du in deinem Team ein positives Klima durch Vorbild und soziale Kompetenz, folgen dir deine Mitarbeiter gerne und freiwillig und zeigen sich häufiger motiviert und einsatzbereit.
Kongruentes Wirken und Auftreten im Zusammenspiel mit Berücksichtigung unterschiedlicher Persönlichkeitstypen ist trainierbar. Eine besonders intensive Methode hierfür, ist das Coaching mit Pferden.
Pferde sind Herden- und Fluchttiere. Um zu überleben, zeichnet sich die Führungspersönlichkeit eines Pferdes durch Achtsamkeit, Erfahrung, Respekt und ständige Präsenz aus. Solange diese Kompetenz spürbar ist, wird die Führung durch die Herde akzeptiert. Pferde reagieren auf menschliche Ausstrahlung, insbesondere in Form von Gefühlen und Körpersprache, in gleicher Weise wie auf einen tierischen Partner. Somit geben sie durch ihr Verhalten ein klares, unmittelbares Feedback, hinsichtlich Authentizität, Sicherheit und Erfüllung der Führungsposition mit allen Erfordernissen. Pferde leben im Hier und Jetzt, reagieren prompt und im Augenblick und entscheiden unmittelbar immer wieder neu. Sie folgen nur demjenigen, der selbstsicher, überzeugend, erfahren und vertrauenswürdig auftritt und sind dabei immer wertfrei. Pferde sind nicht nachtragend und lassen sie sich in jeder Situation wieder neu auf die aktuellen Voraussetzungen und Anforderungen ein.
Als Trainingspartner sind dir Pferde nicht nur ein Spiegelbild deiner eigenen inneren Einstellung, sondern bieten als eigenständige Charaktere und Persönlichkeiten, auch die Möglichkeit deine Wirkung in verschiedenen Situationen auf verschiedene Mitarbeiter testen zu können. Dabei kann menschliches Verhalten sofort reflektiert und Veränderungen in der Realität ausprobiert und verfestigt werden. Es ist kein „Spiel“, es ist Wirklichkeit. Und kann aus unserer eigenen Erfahrung als Trainer und Teilnehmer, mit einer gewissen Transferfähigkeit erfolgreich auf den (Arbeits-)Alltag übertragen werden.
In einer Studie wurde untersucht, inwiefern Pferde im Coaching eingesetzt werden können, um die Selbstwirksamkeitserwartung von Coachees zu erhöhen. Die Ergebnisse zeigen klar, dass sich sowohl die Selbstbewertung als auch die Selbstwirksamkeitserwartung durch ein pferdgestütztes Coaching starke positive Effekte aufwiesen.
Organisationsentwicklung

Quino Al on Unsplash
Mit gemeinsamen Rollenverständnis zu Transparenz und individuellen Gestaltungsspielraum
Von Marcus Winterfeldt
Erfolg in der heutigen Arbeitswelt ist mehr eine Frage des Teams als der individuellen Leistung. Ein Team ist mehr als nur eine Gruppe von Mitarbeitern, die zusammen arbeiten und ihre Arbeit verrichten. Echte Teams sind voneinander abhängig. Das bedeutet, dass sie sich aufeinander verlassen müssen, um die Arbeit zu erledigen. Was sind also Best Practices für effektive Teams?
Lege Rollen und gemeinsame Ziele fest.
Es ist notwendig, die Rollen der Teammitglieder zu definieren und zu strukturieren, um sich auf gemeinsame Ziele und Ergebnisse konzentrieren zu können. Verpflichtende Ziele sind entscheidend für den Erfolg. Im Idealfall ermöglichen Teamziele sowohl dem Team als Einheit als auch den einzelnen Mitgliedern, persönliche und Gruppenziele zu erreichen.
Bestimme, wie das Team Entscheidungen trifft.
Egal, ob der Leiter die Entscheidung trifft oder es sich um einen demokratischen Prozess handelt, das Team muss vorher verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden. Dies reduziert potenzielle Konflikte innerhalb des Teams, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss.
Konzentriere dich auf die kollektive Mission.
Missionsgetriebene Teams leisten mehr, weil sie über ihre individuelle Arbeitsbelastung und Aufgaben hinausblicken und sich fühlen, als würden sie für einen höheren Zweck arbeiten.
Biete klares und konstantes Feedback.
Teams müssen Verhalten reflektieren, um motiviert zu bleiben und Leistungsprobleme oder Ineffizienzen zu beheben. Im Idealfall erhalten die Teammitglieder während der Arbeit laufend Feedback.
Halte die Teamzusammensetzung stabil.
Gerade bei komplexen Aufgaben braucht es viel Zeit, bis die Teammitglieder lernen, auf einem optimalen Niveau zusammenzuarbeiten. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Dauer der gemeinsamen Arbeit und der Erfolgsbilanz des Teams.
Fördere das Hinterfragen des Status Quo.
Wenn Teammitglieder der Meinung sind, dass Verbesserungen möglich sind, müssen sie sich sicher fühlen, Prozesse kritisch zu hinterfragen. Um innovativ zu sein, müssen Teams offen konstruktive Kritik an bestehenden Praktiken berücksichtigen.
Verwende teamfokussierte Anreizsysteme.
Eine zu starke Betonung individueller Anreizkomponenten wirkt gemeinsamen Teamzielen entgegen. Eine Kombination aus individueller und teamorientierter Belohnung ist oft am besten.
Schaffe eine Lernumgebung.
Betone die Entwicklung des Teams, indem sie durch Erfolge, aber vor allem durch Fehler lernen. Ein Team mit einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und der Motivation der Mitglieder, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, ist leistungsstark.
Diese Regeln gelten für Teams mit formal ernanntem Leiter oder selbstverwalteten Teams. Der Schlüssel liegt in der Investition von Zeit und Energie, um diese Regeln einzuhalten.
Leadership

Annie Spratt
Das Kreuz mit dem Projekterfolg
Von Marcus Winterfeldt
Es ist nicht zum Aushalten! Du hast alles gemäß Lehrbuch des Projektmanagements gemacht, dennoch läuft Dein Projekt nicht. Den anfänglichen Zeitplan hast Du bereits mehrfach verlängert, das geplante Budget wird bei weitem nicht ausreichen, Dein Projekt-Sponsor klagt über fehlende Zwischenerfolge und das Projektteam ist frustriert. Was nach einer Katastrophe klingt, gehört in vielen Unternehmen zum Alltag.
Immer wieder kommen Studien im wesentlichen zum Ergebnis, dass nur ca. jedes achte Unternehmensprojekt die Erwartungen erfüllt und die gesteckten Projektziele voll erreicht. Eine Studie berichtete z. B., dass bei 38 Prozent von 250 befragten Unternehmen Projekte komplett gescheitert sind oder maximal 50 Prozent der Ziele erreicht haben. Fast die Hälfte aller Projekte verläuft komplett im Sande oder wirkt sich wertvernichtet auf den Unternehmenserfolg aus.
Eine Untersuchung von knapp 1.000 Großprojekten kommt zu dem Fazit, dass neun von zehn Projekten das ursprüngliche Budget überschreiten und den anfangs entworfenen Zeitplan nicht einhalten. Im Schnitt lagen die tatsächlichen Kosten um 55 Prozent über dem ursprünglichen Budget.
„Blind Spots“ der Unternehmen sind vor allem Wille und die Bereitschaft einer Organisation und ihrer Mitarbeiter, sich wirklich nachhaltig auf den Pfad der Veränderung zu begeben. Wer kennt das nicht: Wann verlassen wir euphorisch und bereitwillig unsere Komfortzone und machen uns auf zu neuen Ufern. Wir sprechen von menschlichem Verhalten, aus dem in ambitionierten Projekten schnell Fallstricke werden können, weil sie die eigentlichen Projektziele unterlaufen.
Vor allem in komplexen, technisch anspruchsvollen und den meisten großen Projekten vertiefen sich Management und Projektteam zu sehr in eine „Klein-Klein-Planung“ anstatt sich in kleinen Schritten auf die Umsetzung zu konzentrieren. Wer liefert was und wann? Wie viel Budget ist für welche Aktivität nötig? Wie werden die Meilensteine angeordnet? Wie sieht die Projektorganisation exakt aus? Wer entscheidet mit wem und wann? Doch die ausgefeilteste Projekt-Governance und -planung suggeriert schnell eine perfekte Scheinwelt, die in der Realität selten besteht. Anders gesagt: Was in PowerPoint kontrollierbar scheint, gestaltet sich im Projektalltag fast immer anders.
Situationen sind meist komplexer, als sie sich anfänglich in der Planung darstellen. Gleichzeitig suchen Projektteams, für ihre Pläne die Unterstützung des Managements. Ausufernde Verweise auf mögliche Komplexitäten und deutliche Risiken wären da eher kontraproduktiv. Die Realität wird allerdings jeden Projektleiter schnell einholen, der sich nicht ausreichend mit der Komplexität beschäftigt.
Die Kernaufgabe modernen Managements besteht darin, ein multidimensionales Puzzle in einem sich ständig verändernden Umfeld zu lösen. Übliche Standardtools für das Projektmanagement bleiben unabdingbar. Doch die tendenziell eher steigende Komplexität von Projekten erfordert ergänzende, flexiblere Werkzeuge, die Unternehmen in die Lage versetzen, während der gesamten Projektdauer angemessene und schnelle Entscheidungen im jeweiligen Kontext zu treffen. Dazu gehören neue Analysemethoden und agile Ansätze, inkrementelle Entwicklungsschleifen, angemessene Entscheidungskompetenzen, punktuelle Beschleunigung von Entscheidungsprozessen und ein multidisziplinäres Projektteam mit erfahrenen Projektleitern und idealerweise auch Change Managern.
Je präziser ein Unternehmen das Zielszenario beschreibt, desto besser lässt sich ein Projekt steuern – und umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, am Ende erfolgreich zu sein. Ein Zielszenario das nur allgemein gehaltene Vorhaben wie „mehr Kundenorientierung“ oder „schnellere Entscheidungsprozesse“ beinhaltet, ist unzureichend. Setze einen realistischen Zielkorridor, den Du durch Dein Projekt erreichen möchtest.
Benötigst Du Hilfe bei der Ausarbeitung Deiner Projektziele? Ich unterstütze Dich gerne bei der Problemanalyse und der anschließenden Zieldefinition. Du kennst die Methoden modernen Projektmanagements aus der Theorie, Dir fehlt jedoch praktische Erfahrung in der Umsetzung? Externe Projektleiter und Change Manager verfügen über langjährige Erfahrung im Projektmanagement und unterstützen Dich nicht nur beratend, sondern ganz konkret bei der Umsetzung. Die passenden Führungskräfte und Fachexperten für Dein Projekt findest Du in meinem Netzwerk. Sprich mich gerne an!
Leadership
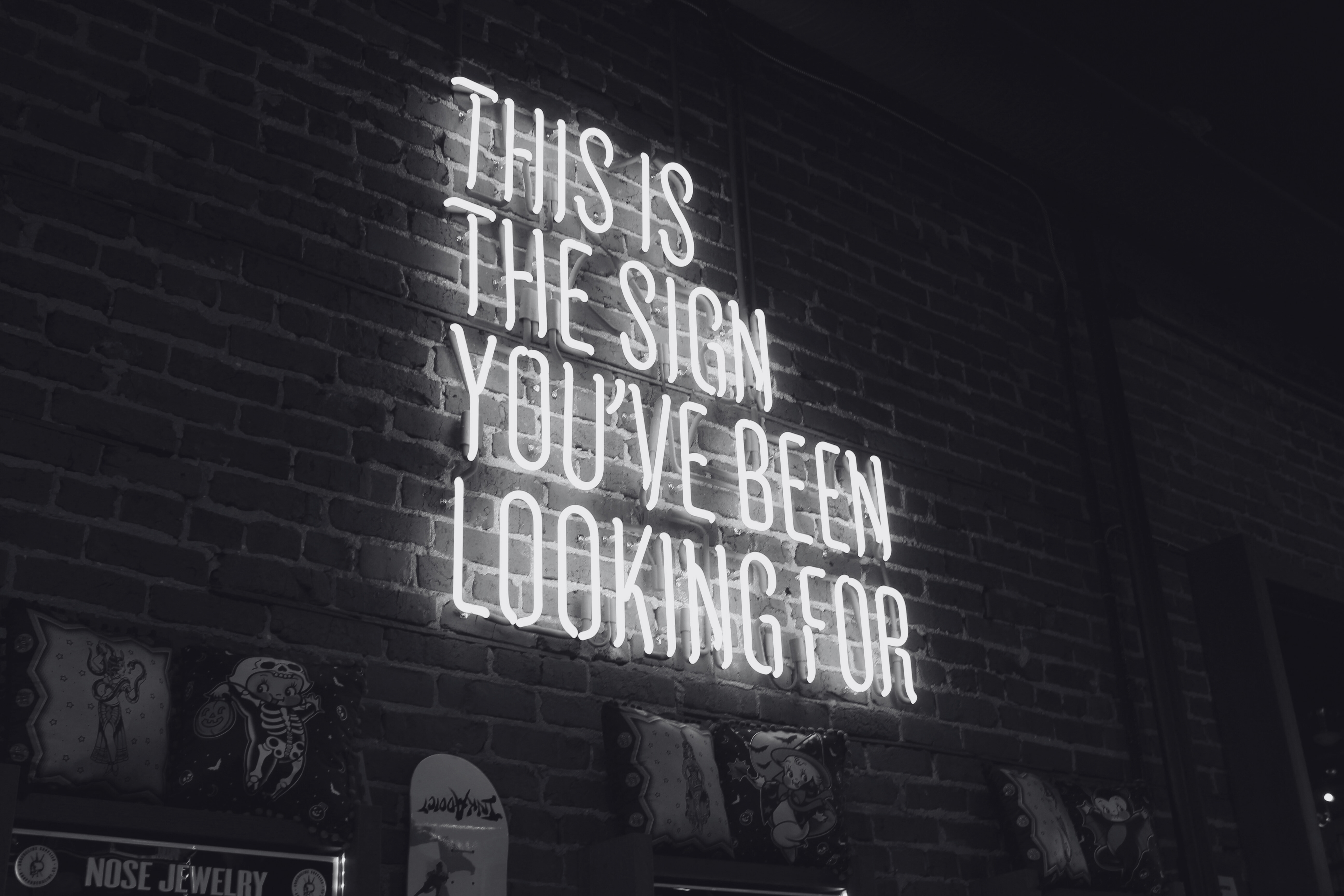
Austin Chan
Aus dem Werkzeugkasten eines Organisationsentwicklers
Von Marcus Winterfeldt
Was machen Organisationsentwickler, wenn sie in Teams an einen Punkt kommen, an dem die Teamentwicklung nicht weitergeht? Wie gelingt es, die unterschiedlichen Facetten der Situation zu erkennen?
Systemische Fragen helfen Organisationsentwicklern, eine Situation umfassend zu erhellen. Du gehst auf Spurensuche nach den wahren Ursachen, schaust genau hin und hinterfragst. Du erkennst, dass das Sichtbare meinst nur ein kleiner Teil des betrachteten sozialen Systems ist. Du bekommst heraus, was sich alles hinter einem zunächst vordergründigen Problem verbirgt und was deine Bezugsgruppe oder Dein Gesprächspartner denkt, will und fühlt.
Ursprung systemischer Fragen sind unterschiedliche Fragetypen aus der systemischen Beratung und Therapie. Du als Fragsteller erschließt mit Deinen Fragen neben den Fakten auch Gefühle, Meinungen oder Einschätzungen und eröffnest damit dem Befragten neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Du betrachtest das Problemfeld als ganzheitliches System aus der Vogelperspektive, das sich aus vielen unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Dein Ziel ist stets die positive Irritation deines Gesprächspartners, um ihn von Fixierungen auf die eigene Sichtweise und verankerte Verhaltensweisen zu lösen. Durch sein Einlassen auf andere Ansichten, Einstellungen und Werte wird erkennbar, welche Wechselwirkungen und komplexen Zusammenhänge existieren. Das eröffnet ihm oft neue, überraschende und für die Lösung förderliche Erkenntnisse. Die oft verborgenen Antriebskräfte und Motivationsfaktoren bei ihm oder bei der Bezugsgruppe werden deutlich. Warum ist das so? Informationen werden nicht nur abgefragt, sondern durch Bedenken und Überlegen der Antworten erst erschaffen.
Im folgenden findest Du meine (unvollständige) Sammlung systemischer Fragen:
Was genau ist das Problem?
Woher wissen Sie, dass ... problematisch ist?
Wer hat ein Interesse, dass es nicht zu einer Lösung kommt?
Wie wirkt sich das Problem aus?
Was darf angesprochen werden? Was nicht?
Sehen alle das Problem gleich?
Wer hat eine andere Sichtweise?
War das schon immer so? Wann hat sich das verändert?
Wie ging man früher damit um?
Wie wurde ... früher gelöst?
Was wurde zur Lösung von...bereits getan?
Was hat dabei funktioniert/ nicht funktioniert
Welche Vorteile haben Sie, wenn...?
Welche Vorteile haben andere, wenn ...
Wie erklären Sie, dass ...?
Angenommen die Unternehmensleitung würde ...: Was wäre dann mit ...?
Wenn Ihr Mitarbeiter Sie fragen würde, ob ...: Was würden Sie antworten?
Was wäre passiert, wenn Sie ... (nicht) gemacht hätten?
Angenommen, es passiert nichts: Was wäre dann mit ...?
Würden Sie beim nächsten Mal wieder ...?
Wie würden Sie (re-) agieren, wenn Sie der Chef wären?
Wer würde als erster erkennen, dass ...?
Was vermutet denn Ihrer Meinung nach der Betriebsrat, welche Ziele die Unternehmensleitung verfolgt? (triadisch)
Wie würden die Mitarbeiter reagieren, wenn der Chef so vorgeht?
Was würde Herr Meier sagen, wenn Sie ihn fragen ...? (dyadisch)
Wenn wir Frau Müller einmal durch eine Videokamera betrachten: Was würde ich sehen?
Wie würde ein außen stehender Beobachter ... beschreiben?
Stellen Sie sich vor, das Problem … wäre gelöst: Woran würden Sie dies erkennen?
Was wäre ein Anzeichen dafür, dass sich ... ändert?
Angenommen die neue Lösung würde funktionieren: Was wäre dann mit ...?
Angenommen Sie hätten einen Wunsch frei: Was würden Sie ...?
Was würde die Kollegen am meisten auf die Palme bringen?
Was genau meinen Sie mit ...?
Was soll bleiben? Was soll sich ändern?
Was genau macht ...?
Woran zeigt sich das genau?
Was lässt sich beobachten, wenn ...?
Wie hoch schätzen Sie auf einer Skala von 1 bis 10 ein: ...?
Was sind die drei größten Probleme?
In welche Reihenfolge für … würden Sie ... bringen?
Wichtig dabei ist: Höre aufmerksam zu! Achte auch auf Gestik, Mimik, Stimme und Tonlage. So wird sichtbar und hörbar, was der Gesprächspartner übersieht oder vielleicht falsch einschätzt.
Und Vorsicht: Systemische Fragen können beim Befragten nicht nur Irritationen, sondern auch negative Emotionen auslösen. Erkläre, warum du so vorgehst, welche Rolle du hast, was du erreichen willst: Sichtweisen erkennen, nicht die Wahrheit herausfinden.
Leadership

Carl Heyerdahl
Tipps und Tricks für virtuelle Teams
Von Marcus Winterfeldt
Egal, ob Du zum ersten Mal ein Work-at-Home Team führst oder schon ein alter Hase bist, Dein Ziel ist, dass Deine Mitarbeiter im Home-Office genauso produktiv sind wie vor Ort im Büro. Jedem Team sollte geholfen werden, sich individuell auf die neue Situation einzustellen.
Die drei wichtigsten Parameter bei der Führung auf Distanz sind Kommunikation, Verbundenheit und Vertrauen.
Kommunikation ist der Eckpfeiler jeder funktionierenden Gruppe und herausfordernd für räumlich getrennte Teams. In Zeiten von Zoom, Slack, Microsoft Teams, Jira und Trello sind eine Vielzahl unterstützender Werkzeuge vorhanden, die nur professionell bespielt werden müssen. Die Rolle der Führungskräfte ist hier zu moderieren und präsent zu sein für Probleme, Ideen, Gedankenaustausche, Entscheidungen etc. Proaktiv sollte die Führungskraft deutlich häufiger als üblich Arbeitsfortschritte, Zwischenstände und Status weitergeben, um ein Gefühl von Fortschritt zu vermitteln.
Unter räumlicher Trennung leiden besonders der Teamspirit und das Gefühl von Verbundenheit. Mitarbeiter fühlen sich schon nach kurzer Zeit von Team und Unternehmen entkoppelt. Der Effekt wird verstärkt, da Mitarbeiter beginnen, nur noch beruflich zu kommunizieren. Starke persönliche Bindungen entstehen durch den kurzen Austausch vor oder nach Meetings, an der Kaffeemaschine oder beim gemeinsamen Mittagessen. Für Work-at-home Teams ist es hochrelevant, sich hierfür bewusst Zeit zu nehmen. Insbesondere anfangs ist es ratsam einen Rahmen vorzugeben — etwa zu Beginn einer Video- oder Telefonkonferenz. Dies stärkt die Verbindung untereinander und schafft das Gefühl, weiterhin Teil des Ganzen zu sein.
Vertrauen ist die psychologische Sicherheit, die man gegenüber einem Individuum oder Team spürt. Wenn Vertrauen zwischen den Kollegen besteht, ist das ein Motor für den Erfolg eines jeden Teams. Persönliche Interaktion und Kommunikation schaffen Vertrauen. Bei Work-at-home Teams steht dieser Vorteil in Frage: arbeiten die Anderen wirklich genauso entschieden an unseren Themen wie ich? Selbst wenn Führungskräfte ihre Teams voller Vertrauen ins Homeoffice entlassen, bedeutet das noch lange nicht, dass dieses Vertrauen auch unter den Teammitgliedern geteilt wird. Tragisch ist, dass das Mißtrauen zu einer Abwärtsspirale der eigenen Motivation und letztlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Work-at-Home Teams brauchen also ein höheres Maß an Vertrauen zueinander, um zu funktionieren. Wie schafft man dies bei einem Team, das sich nicht am gleichen Ort befindet? Wie baut man Vertrauen zu Menschen auf, die man noch nie getroffen hat? Der Schlüssel ist die eigene Haltung, die von Respekt und Aufmerksamkeit geprägt ist. Bau Vertrauen auf, und Dein Team wird gedeihen, zusammenarbeiten und innovativ sein. Alles, was es braucht, ist ein wenig Vorbereitung und die richtige Denkweise.
In einem Team vor Ort bauen wir durch unsere regelmäßigen täglichen Interaktionen Vertrauen auf. Ein gemeinsamer Kaffee, ein Mittagessen, ein Small-Talk im Aufzug oder ein gemeinsames Meeting helfen uns, uns gegenseitig zu verstehen. Das sagst du alles oben schon, könnte man den weglassen? Denken wir jetzt an Work-at-Home Kollegen: Es gibt keine Chance für diese beiläufigen Treffen, diese zufälligen Begegnungen, diese persönliche Sozialisierung, die Sie mit Ihrem Team vor Ort erreichen. Die Interaktionen erfolgen per E-Mail, Chat oder Video. Sie ist selten und unpersönlich und behindert den Aufbau von Vertrauen. Es muss also anderes gehen. Und das ist nicht allzu schwierig, wenn man es richtig angeht:
Damit ein Team effektiv zusammenarbeiten kann, ist es hilfreich die unterschiedlichen Arbeitsstile zu kennen. Lass jedes Teammitglied über seinen Arbeitsstil, seine Fähigkeiten, seine Stärken und seine möglichen Aufgaben berichten. Mach Dir ein Bild davon, wie das Team gerne kommuniziert, wie viel Autonomie es mag und wie es gerne mit anderen zusammenarbeitet. Wenn Du alle Informationen zusammengetragen hast, erstelle eine Team-Charta. Lege darin fest, wie das Team zusammenarbeiten wird. Versuche die individuellen Arbeitsstile so weit wie möglich in der Charta unterzubringen und teile sie dann mit dem Team. Die Team-Charta hilft Dir, die Dynamik deines Teams zu verstehen. Bitte jedes Teammitglied per E-Mail oder Chat um Beantwortung der folgenden Fragen:
Was ist Deine Sicht auf Führung? Hierarchisch oder flach?
Bevorzugst Du eine Entscheidungsfindung von oben nach unten oder eine auf Konsens basierende?
In welchen Situationen oder Zeitfenstern kannst Du dich nicht an Teammeetings beteiligen?
Bist Du strategisch oder detailorientiert?
Was ist Dir wichtig, bei auftretenden Konflikten?
Sobald die Team-Charta steht, ist es Zeit für den Kick-Off. Er schafft ein positives und kooperatives Umfeld und startet das Team aus einer Vertrauensposition heraus. Ein Remote-Kick-Off kann gut funktionieren, wenn Du ihn gut führst. Mach den Einstieg so gesellig wie möglich und finde den richtigen Ton. Ergänze Deine Skype- oder Zoom-Einladung um eine Agenda und Bitten an die Teilnehmer: ihre Biographien im Voraus zu teilen, ein Foto zu schicken und ihre Biographie und Foto der Team-Charta hinzuzufügen.
Teile im Kick Off die Fakten mit der Gruppe und stellt euch gegenseitig Fragen. Das Team lernt sich gegenseitig kennen, baut engere soziale Bindungen auf und schafft die Basis für Vertrauen.
Es gibt eine einfache Regel, die zu befolgen ist, um das Vertrauen in einem Work-at-home Team aufrechtzuerhalten: Kommunizieren, kommunizieren und noch mehr kommunizieren. Kommuniziere weit mehr als mit einem vor-Ort Team, um den Mangel an persönlichen Treffen auszugleichen. Variiere die Art und Weise, wie du kommunizierst per Telefon, Chat, E-Mail, Video usw. und richte ihn auf die Bedürfnisse der Einzelnen aus. Ein Kommunikationsstil passt nicht für alle. Eine häufige Kommunikation hilft, ein besseres Gefühl für Konflikte oder Spannungen zu bekommen, die das Vertrauen zerstören könnten. Führe mehr Einzelgespräche mit den Teammitgliedern und höre Dir an, was ihnen durch den Kopf geht. Damit kommst Du entstehenden Spannungen auf die Spur.
Regelmäßige Rituale halten als Bestandteil Deiner Teamkultur die Aufmerksamkeit Deines Teams hoch. Sie dienen der Kompensation persönlicher Vor-Ort Kommunikation. Z. B. Halte Freitagnachmittag eine Kaffeepause über Video ab. Verzichte dabei auf Arbeitsgespräche und tausche Dich stattdessen über Wochenendpläne aus, was Du gerade liest oder wie ihr euch die Zeit vertreiben werdet. Mach das zu einem wöchentlichen Ritual. Oder beginne jedes Gespräch mit einem Smalltalk, um soziale Beziehungen zu stärken. Richte einen Slack-Kanal ein, um Offline-Small-Talk zu führen oder lustige Inhalte zu teilen; #stupidvideos wird garantiert ein Hit. Ich höre schon die Rufe: „Das ist aber unprofessionell. Das mache ich nicht. Da verstoß ich dann vielleicht noch gegen Urheberrechte.“ Überleg Dir das nochmal: es geht darum, Vertrauen zwischen Menschen aufzubauen, die zusammenarbeiten und Menschen mögen es, Spaß miteinander zu haben.
Wenn Du Dein Work-at-Home Team zerstören willst, sei Mikro-Manager. Zeige stattdessen Vertrauen in Dein Team, indem Du ihm Autonomie und Handlungsspielraum gibst. Lass das Team wissen, dass Du sie als kompetente Fachleute betrachtest, die das Richtige tun werden und dass sie sich gegenseitig genauso sehen sollten. Mach Autonomie und Handlungsfähigkeit zu Grundwerten Deines Teams.
Welche Erfahrungen hast Du mit Work-at-Home gemacht? Schreib mir.
Organiationsentwicklung
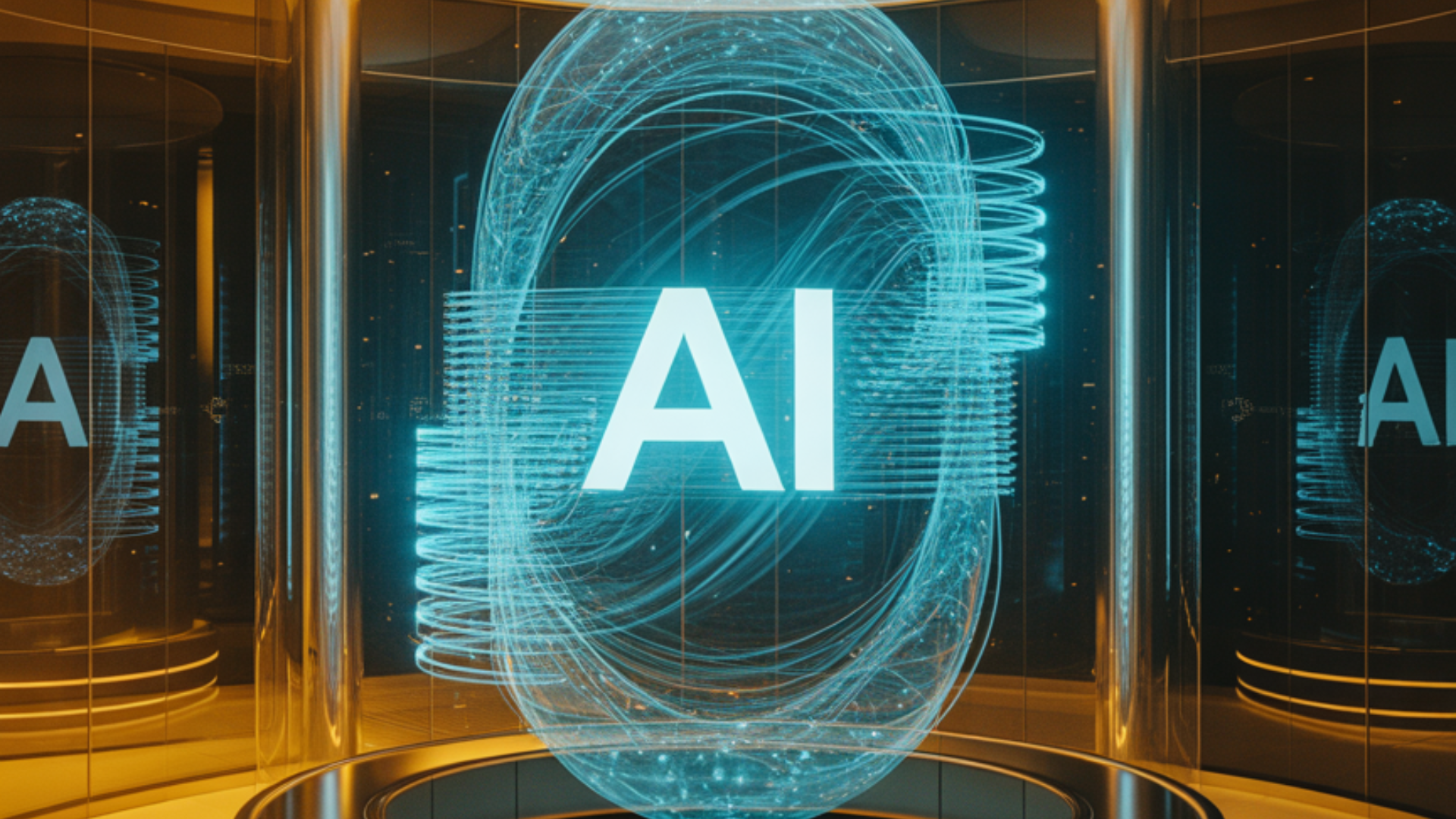
Eine Metaanalyse von 10+ Studien
Von Marcus Winterfeldt
Die deutsche Wirtschaft steht vor tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen. Ein zunehmender Fachkräftemangel, eine seit Jahren stagnierende Produktivität und nachlassende Innovationskraft bedrohen das Fundament von Wachstum und Wohlstand (IW-Report, 2025). In diesem Kontext avanciert Künstliche Intelligenz (KI) zu einer strategischen Notwendigkeit. KI bietet als Querschnittstechnologie das Potenzial diesen Herausforderungen durch Automatisierung, Effizienzsteigerung und die Erschließung neuer Wertschöpfungsquellen wirksam zu begegnen.
Bei der Adoption von KI in Deutschland zeigt sich jedoch ein widersprüchliches Bild: das „Deutsche KI-Paradoxon“. Einerseits weisen deutsche Unternehmen eine im internationalen Vergleich hohe Adoptionsrate auf: Laut einer Deloitte-Studie berichten 39 % der Unternehmen von einer vollständigen Integration von KI in ihre Arbeitsprozesse, was 6 Prozentpunkte über dem globalen Durchschnitt liegt. Andererseits wird die strategische Bedrohung durch KI auffallend gering eingeschätzt. Fast die Hälfte der deutschen Befragten (47 %) sieht wenig bis keine Gefahr für ihr Geschäftsmodell durch KI – ein Wert, der signifikant über dem globalen Durchschnitt von 37 % liegt.
Diese Diskrepanz ist keine bloße statistische Anomalie, sondern ein Symptom für einen strategischen blinden Fleck. Sie offenbart eine strategische Reifegradlücke: Deutsche Unternehmen behandeln KI vorwiegend taktisch als Werkzeug zur Effizienzsteigerung, anstatt sie strategisch als Motor für die Transformation von Geschäftsmodellen zu begreifen. Befunde aus dem IW-Report (2025) stützen diese These und legen nahe, dass die KI-Nutzung oft nur punktuell und oberflächlich erfolgt, beispielsweise durch den Einsatz kostenfreier, nicht-integrierter Tools. Diese generelle Zurückhaltung bei der tiefgreifenden Implementierung wird auch durch die Studie von Ruess et al. (2024) belegt.
Ziel des Beitrags ist, Führungskräften einen praxisorientierten und wissenschaftlich fundierten Leitfaden an die Hand zu geben, um diese Reifegradlücke zu schließen. Er zeigt auf, wie Unternehmen KI nicht nur implementieren, sondern sie strategisch so verankern können, dass sie nachhaltig Wert stiftet und die Wettbewerbsfähigkeit sichert.
Kapitel 2 analysiert aus einer Metaperspektive die übergreifenden Erfolgsmuster von KI-Transformationen.
Kapitel 3 stellt ein konkretes 8-Phasen-Vorgehensmodell zur Implementierung von KI vor – von der Vision bis zur Skalierung.
Kapitel 4 beleuchtet die dafür notwendigen Rollen, Fähigkeiten und die organisatorische Verankerung in einem Operating Model.
Kapitel 5 vertieft die strategische Bedeutung von Governance und Responsible AI als Wettbewerbsvorteil.
Kapitel 6 analysiert typische Stolpersteine, insbesondere die gefürchtete „Pilot-Falle“.
Kapitel 7 bündelt die Top-Erfolgsfaktoren und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen für verschiedene Unternehmensebenen ab.
Kapitel 8 schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Ergebnis ist ein strategischer Kompass, um über die reine Technologieeinführung hinauszublicken und die fundamentalen Muster erfolgreicher KI-Transformationen für Ihren nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu nutzen.
Eine erfolgreiche KI-Transformation ist mehr als die Summe einzelner Technologieprojekte. Sie erfordert ein tiefes Verständnis der übergreifenden Muster, die den Unterschied zwischen oberflächlicher Anwendung und strategischer Verankerung ausmachen. Die Analyse führender Unternehmen und wissenschaftlicher Studien zeigt, dass KI dann am wirksamsten ist, wenn sie als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen und ganzheitlich im Unternehmen verankert wird.
Aus der Synthese aktueller Forschung lassen sich drei Kernmuster identifizieren, die erfolgreiche KI-Transformationen auszeichnen.
Erfolgreiche Unternehmen betrachten die KI-Implementierung als ein Zusammenspiel technologischer, organisatorischer und externer Umweltfaktoren. Das Technologie-Organisation-Umwelt (TOE)-Framework bietet hierfür ein bewährtes Analyse-Raster (Yang et al., 2024; Schwaeke et al., 2025; Romeo & Lacko, 2024).
Technologische Faktoren: Hier geht es um ihre Kompatibilität der KI mit bestehenden Systemen und Prozessen. Eine nahtlose Integration ist entscheidend, um Datensilos zu vermeiden und Skaleneffekte zu erzielen (Schwaeke et al., 2025). Ebenso zentral ist die wahrgenommene Nützlichkeit (Perceived Usefulness): Nur wenn die Anwender einen klaren Mehrwert erkennen, wird die Technologie angenommen und genutzt (Kelly et al., 2022).
Organisatorische Faktoren: Technologie allein schafft keinen Wandel. Entscheidend sind das unmissverständliche Commitment des Top-Managements, eine ausgeprägte Innovationskultur und die Bereitstellung adäquater finanzieller Ressourcen. Eine der größten Hürden ist jedoch der Aufbau einer robusten Dateninfrastruktur. Ohne qualitativ hochwertige und verfügbare Daten bleiben selbst die besten KI-Modelle wirkungslos (Heimberger et al., 2024; Yang et al., 2024).
Ökologische (Umwelt-)Faktoren: Der Wettbewerbsdruck kann die KI-Adoption massiv beschleunigen. Gleichzeitig prägen regulatorische Rahmenbedingungen, wie der EU AI Act, die strategischen Leitplanken, innerhalb derer sich Unternehmen bewegen müssen. Erfolgreiche Organisationen antizipieren diese externen Faktoren und integrieren sie proaktiv in ihre Strategie (Yang et al., 2024).
Die größten Herausforderungen bei der KI-Implementierung sind oft ethischer und regulatorischer Natur. Dazu gehören die Überwindung des „Black-Box“-Problems (mangelnde Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen), die Schließung ethischer Lücken (z. B. Bias und Diskriminierung) und die Handhabung regulatorischer Komplexität.
Erfolgreiche Unternehmen begreifen Governance jedoch nicht als Bürde, sondern als strategisches Instrument zur Vertrauensbildung und Risikominimierung (Mikalef et al., 2022). Eine proaktiv gestaltete Responsible AI (RAI)-Governance wird zum Qualitätsmerkmal, das das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden und Regulatoren stärkt und somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt.
Die erfolgreichsten Unternehmen nutzen KI, um ihre Geschäftsmodelle grundlegend neu zu gestalten und die vollen Potenziale der Technologie auszuschöpfen (Deloitte, CEO's Guide). Yang et al. (2024) beschreiben in diesem Zusammenhang unterschiedliche Wirkungspotenziale von KI, deren Wahl stark von der KI-Durchdringung im Wettbewerbsumfeld abhängt:
Wirkungspotenzial Marketing: Vor allem kleinere Unternehmen in Märkten mit geringer KI-Nutzung setzen KI primär als Aushängeschild ein, um sich als innovativ zu positionieren. Dies kann ein rationaler, kosteneffektiver erster Schritt sein, der strategische Nutzen bleibt jedoch oberflächlich.
Wirkungspotenzial Operationale Exzellenz: Größere, reifere Unternehmen in Märkten mit hoher KI-Durchdringung setzen KI gezielt als Treiber für operative Exzellenz ein. Sie zielen auf tiefgreifende Verbesserungen bei Effizienz, Qualität und Kundenerlebnis ab, was eine umfassende KI-Adoption erfordert. Hier ist der reine Marketing-Aspekt wettbewerbsirrelevant.
Das deutsche KI-Paradoxon ist somit das direkte Resultat der Missachtung dieser Erfolgsmuster. Eine punktuelle Technologieeinführung ohne ganzheitlichen Fähigkeitsaufbau (Muster 1), ohne robustes Governance-Fundament (Muster 2) und ohne die Bereitschaft zur Geschäftsmodellinnovation (Muster 3) führt zwangsläufig zu der beobachteten Diskrepanz zwischen hoher Adoption und geringer strategischer Wahrnehmung. Das Verständnis dieser strategischen Muster ist die Voraussetzung dafür, die Potenziale von KI voll auszuschöpfen. Der nächste Schritt besteht darin, diese Muster in ein konkretes, operatives Vorgehensmodell zu überführen.
Die Komplexität der KI-Implementierung erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Zu viele Initiativen starten als isolierte Experimente und scheitern in der „Pilot-Falle“, ohne jemals skaliert oder in den produktiven Betrieb überführt zu werden. Ein systematisches Phasenmodell hilft, diese Falle zu umgehen, indem es von Beginn an die strategische Verankerung, die technische Skalierbarkeit und die organisatorische Befähigung mitdenkt.
Das folgende Modell gliedert die KI-Transformation in acht logische Phasen, die den Weg von der ersten Idee bis zum skalierbaren, wertstiftenden Betrieb aufzeigen.
Jede erfolgreiche Transformation beginnt mit einer klaren Vision. Das Management, insbesondere der CEO, muss einen überzeugenden Zielzustand („Compelling Point of Arrival“) definieren und diesen mit einem soliden Business Case untermauern (Deloitte, CEO's Guide). Anstatt KI als Selbstzweck zu betrachten, werden konkrete Anwendungsfälle (Use Cases) identifiziert und priorisiert, die auf die strategischen Unternehmensziele einzahlen. Typische Ziele sind dabei:
Entlastung der Mitarbeitenden von Routinearbeiten
Unterstützung bei komplexen analytischen Aufgaben
Verbesserung der Qualität von Prozessen und Entscheidungen (IW-Report, 2025)
Strategisches Gebot: Eine vom Top-Management getragene Vision, die über reine Kostensenkung hinausgeht und das transformative Potenzial von KI für das Geschäftsmodell aufzeigt, ist notwendig.
Ohne einen quantifizierbaren Business Case und eine klare Vision verkommt die KI-Strategie jedoch zu einer unkoordinierten Sammlung von „Piloten“ ohne nachhaltigen Wert fürs Geschäft.
KI ist fundamental von Daten abhängig. Daher ist die Schaffung einer robusten Dateninfrastruktur und die Sicherstellung einer hohen Datenqualität eine unabdingbare Voraussetzung (Yang et al., 2024; Heimberger et al., 2024). In dieser Phase werden Datensilos aufgebrochen, Daten-Governance-Prozesse etabliert und die technologische Plattform für die Skalierung vorbereitet. Insbesondere für KMU stellen mangelnde Datenverfügbarkeit und fragmentierte Systemlandschaften eine erhebliche Hürde bei der Implementierung von KI dar (Yang et al., 2024; Schwaeke et al., 2025).
Strategisches Gebot: Behandeln Sie Daten als strategisches Asset mit dedizierter Verantwortung (vgl. Rolle Data Steward) und Budget.
Ohne exzellente Daten ist exzellente KI unmöglich. Mangelhafte Datenqualität führt zu unzuverlässigen KI-Modellen und untergräbt das Vertrauen in die Technologie.
Verantwortungsvoller Umgang mit KI (Responsible AI, RAI) muss von Anfang an mitgedacht werden. In dieser frühen Phase wird ein Governance-Rahmenwerk geschaffen, das ethische Leitplanken, rechtliche Compliance (z.B. EU AI Act, DSGVO) und interne Richtlinien definiert. Ein zentrales Instrument sind proaktive Impact Assessments, bei denen die potenziellen Risiken und Auswirkungen eines KI-Systems auf Betroffene systematisch analysiert und bewertet werden. Diese Praxis ist nicht nur ethisch geboten, sondern wird auch durch den EU AI Act (Art. 9) zunehmend rechtlich verankert (Papagiannidis et al., 2025).
Strategisches Gebot: Frühe Etablierung eines RAI-Frameworks, das von einer dedizierten Rolle (z.B. RAI Officer) verantwortet wird, schafft Vertrauen und minimiert Risiken.
Nachträgliche Governance-Anpassungen sind teuer, ineffizient und erhöhen Compliance- und Reputationsrisiken. Sie sind ein Hauptgrund für das Scheitern in der Skalierungsphase.
In dieser Phase werden die priorisierten Use Cases in überschaubaren Experimenten und Proofs of Concept (PoCs) validiert. Ziel ist es, schnell zu lernen, die technische Machbarkeit zu beweisen und den potenziellen Business Value zu demonstrieren. Laut Deloitte verfolgen deutsche Unternehmen eine beträchtliche Anzahl an PoCs, was auf eine hohe Experimentierfreudigkeit hindeutet. Die große Gefahr liegt jedoch in der bereits erwähnten „Pilot-Falle“: Viele PoCs werden ohne eine klare Strategie für die Überführung in den produktiven Betrieb entwickelt und versanden nach der ersten erfolgreichen Demonstration.
Strategisches Gebot: Jeder PoC wird mit einer klaren Hypothese zum Business Value und einem vordefinierten Plan zur Skalierung gestartet.
Der Fokus liegt oft allein auf der technischen Machbarkeit, während betriebliche Aspekte ignoriert werden. Dies ist oft eine direkte Folge einer unzureichenden Governance-Planung in Phase 3, was dazu führt, dass Skalierungsrisiken nicht frühzeitig identifiziert werden.
Machine Learning Operations (MLOps) ist die Disziplin, die KI-Modelle aus dem Labor in den stabilen, skalierbaren und überwachten Produktivbetrieb überführt. Sie automatisiert den gesamten Lebenszyklus eines KI Modells und ist das technische Rückgrat für eine erfolgreiche KI-Skalierung. Die fünf zentralen Bausteine einer industrialisierten MLOps-Praxis sind:
CI/CD-Pipelines: Automatisierte Abläufe, die Code-, Daten- und Modelländerungen kontinuierlich testen und sicher in die Produktionsumgebung ausrollen.
Registry (Modell-Register): Eine zentrale, versionierte Bibliothek für alle KI-Modelle, inklusive Metadaten und Freigabehistorie, die Audits und Nachvollziehbarkeit ermöglicht.
Feature Store: Eine zentrale Datenbasis für vorverarbeitete, modellrelevante Merkmale (Features), die als „Single Source of Truth“ für verschiedene Modelle dient und redundante Daten-Pipelines vermeidet.
Drift- & Resilience-Monitoring: Kontinuierliche Überwachung der Modellgüte im produktiven Einsatz, um Leistungsabfälle (Drift) oder Instabilitäten frühzeitig zu erkennen und automatische Re-Trainings anzustoßen.
Security by Design: Integration von Sicherheits- und Datenschutzprinzipien von Beginn an in die Architektur, um Compliance-Verstöße und Reputationsrisiken zu minimieren.
Strategisches Gebot: Aufbau einer zentralen KI-Plattform mit standardisierten MLOps-Komponenten, die von verschiedenen Teams genutzt werden kann, um Geschwindigkeit und Qualität zu sichern.
Andernfalls entwickelt jedes Team eigene Ad-hoc-Lösungen für den Betrieb. Dies führt zu Ineffizienz, Inkonsistenz, hohen Wartungskosten und ist der direkte Weg in die technische Sackgasse.
Technologie und Prozesse allein bewirken keine Transformation – die Mitarbeitenden müssen befähigt und mitgenommen werden. Diese Phase fokussiert sich auf aktives Change Management und die gezielte Qualifizierung der Belegschaft. Um Akzeptanz zu fördern und Ängste abzubauen, ist eine partizipative Gestaltung entscheidend, bei der die betroffenen Mitarbeitenden frühzeitig in den Gestaltungsprozess einbezogen werden (Ruess et al., 2024). Bewährte Instrumente wie Change Readiness Surveys zur Messung der Veränderungsbereitschaft und der Aufbau von Change Ambassador Networks sind hierbei essenziell.
Strategisches Gebot: Eine transparente Kommunikation und die Schaffung echter Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Belegschaft sind ein harter Erfolgsfaktor.
Wird die KI-Einführung jedoch als Top-Down-Entscheidung wahrgenommen, wird sie scheitern. Dieses Risiko wird potenziert, wenn in Phase 1 keine überzeugende Vision kommuniziert und in Phase 3 die ethischen Bedenken der Mitarbeitenden durch Impact Assessments nicht proaktiv adressiert wurden.
Die systematische Messung des geschaffenen Werts („Benefits Realisation“) ist entscheidend, um den Erfolg der KI-Initiativen nachzuweisen und zukünftige Investitionen zu rechtfertigen. Der Wertbeitrag von KI muss dabei sowohl quantitativ (z. B. Effizienzsteigerung in Prozesszeiten, Kostensenkung) als auch qualitativ (z. B. verbesserte Entscheidungsqualität, höhere Mitarbeiterzufriedenheit) erfasst und transparent gemacht werden.
Strategisches Gebot: Etablierung klarer KPIs ex ante vor Projektstart und regelmäßiges, transparentes Reporting.
Wird der Nutzen von KI ohne Messung als selbstverständlich angenommen, schwächt dies die strategische Legitimation und gefährdet Folgeinvestitionen.
Die letzte Phase zielt darauf ab, KI über einzelne erfolgreiche Projekte hinaus im gesamten Unternehmen zu skalieren. Es haben sich drei strategische Ansätze bewährt:
Aufbau einer Community: Förderung des Wissensaustauschs zwischen KI-Praktikern.
Nutzung von Gemeinsamkeiten (Commonality): Identifikation und Wiederverwendung von Daten, Modellen und Plattformkomponenten.
Zentrale Koordination: Eine zentrale Instanz, die Initiativen priorisiert und die Einhaltung von Standards sicherstellt.
Grundlage hierfür ist ein klares Operating Model, das Rollen, Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeitsmodelle für den gesamten KI-Lebenszyklus definiert und so die Grundlage für eine nachhaltige Skalierung schafft.
Ein solches Vorgehensmodell kann jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn es von Menschen mit den richtigen Rollen und Kompetenzen im Unternehmen gelebt und umgesetzt wird.
Technologie und Prozesse bilden das Skelett einer KI-Transformation, doch erst die richtigen Menschen mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten hauchen ihr Leben ein. Ohne eine durchdachte Organisationsstruktur bleiben selbst die besten strategischen Modelle und technischen Plattformen wirkungslos. Erfolgreiche KI-Skalierung ist untrennbar mit der gezielten Entwicklung von personellen Fähigkeiten und der Definition eines klaren Operating Models verbunden.
Die Implementierung von KI erfordert spezialisierte Rollen, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Idee bis zum Betrieb – zusammenarbeiten. Die folgende Tabelle beschreibt vier zentrale Schlüsselrollen.
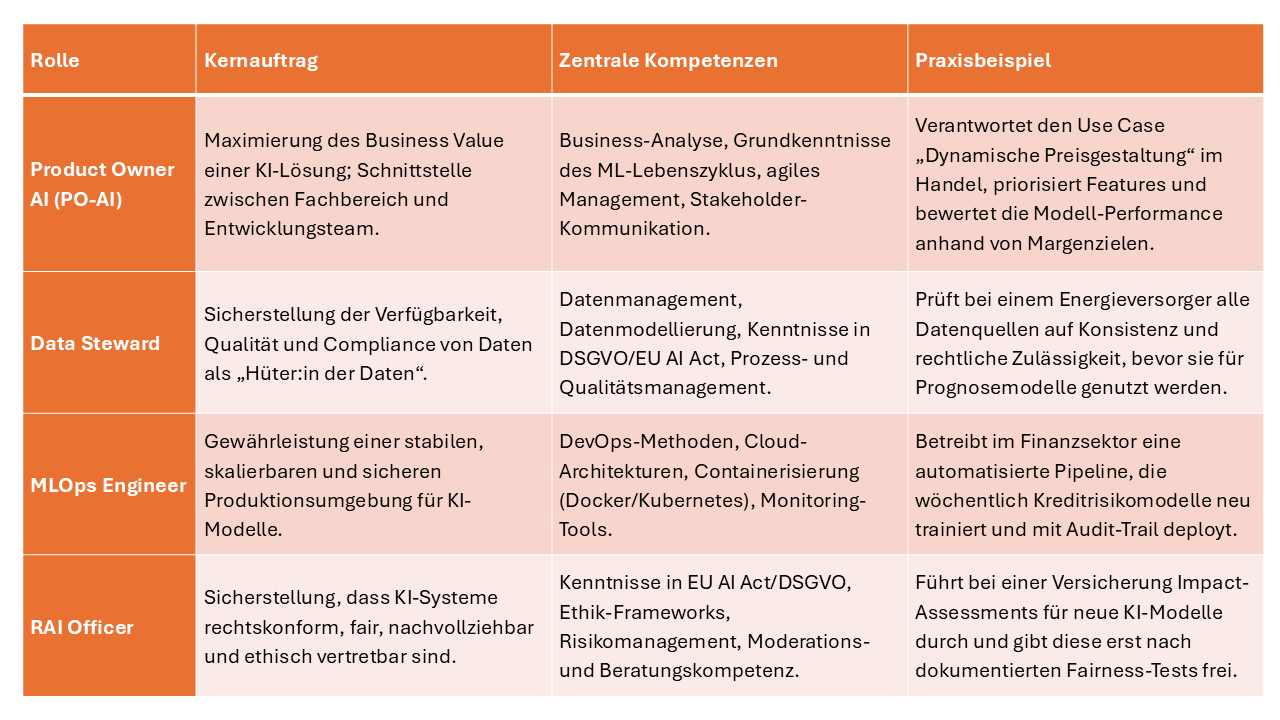
Ergänzend zu diesen Kernrollen sind weitere Akteure entscheidend:
Der KI Champion: Oft eine Führungskraft, die als Visionär und Treiber agiert, Ressourcen sichert und die strategische Bedeutung von KI im Unternehmen verankert (Heimberger et al., 2024).
Der Change Ambassador: Agiert als Kulturvermittler, der die Belegschaft durch den Wandel begleitet, Schulungen organisiert und als Ansprechpartner für Sorgen und Feedback dient.
Diese Rollen arbeiten in einem integrierten Prozess zusammen. Der Prozess beginnt mit der strategischen Vision des KI Champions, die der Product Owner AI in einen validierten Use Case übersetzt. An der kritischen Schnittstelle zur Umsetzung stellt der Data Steward die Datenqualität sicher, während der RAI Officer durch ein Veto im Impact Assessment ethische Leitplanken setzt. Erst nach dieser Freigabe beginnt die technische Implementierung durch den MLOps Engineer, begleitet vom Change Ambassador, der die Brücke zum Fachbereich schlägt. Im Betrieb überwacht der MLOps Engineer die technische Performance, während RAI Officer und Data Steward die inhaltliche und ethische Güte im Blick behalten.
Der Aufbau dieser Rollen erfordert eine gezielte Kompetenzentwicklung, die sich in zwei Ebenen gliedert:
Unternehmensweite KI Befähigung: Ein Grundverständnis von KI-Potenzialen und -Risiken für alle Mitarbeitenden ist die Basis für Akzeptanz und Partizipation. Es hilft, Ängste abzubauen und ermöglicht eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Technologie (Ruess et al., 2024; u. a.).
Expertenwissen: Für die oben beschriebenen Spezialrollen ist tiefgehendes Fachwissen erforderlich, das durch gezielte Qualifizierungsprogramme aufgebaut werden muss. Die McKinsey-Studie zu KI-High-Performern zeigt, dass systematische Qualifizierungsprogramme ein wesentliches Merkmal erfolgreicher Unternehmen sind.
Eine der wichtigsten neuen Kompetenzen, die im gesamten Unternehmen verankert werden muss, ist das Verständnis für und der Umgang mit KI-Ethik und -Regulierung – eine Kompetenz, die durch die Rolle des RAI Officers institutionalisiert wird.
In einer zunehmend datengetriebenen wie regulierten Gesellschaft sind Responsible AI (RAI) und eine robuste Governance keine reinen Compliance-Themen mehr. Sie entwickeln sich zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal in Bezug auf Kundenvertrauen, Reputation und strategisches Risikomanagement. Unternehmen, die proaktiv Verantwortung übernehmen, bauen nachhaltige Wettbewerbsvorteile auf.
Ein effektives RAI-Framework basiert auf konkreten, operativen Kontrollen, die entlang des gesamten KI-Lebenszyklus implementiert werden. Drei dieser Kontrollen sind von zentraler Bedeutung:
Ein Impact Assessment ist ein proaktiver Prozess, um potenzielle Auswirkungen eines KI-Systems auf Menschen, die Organisation und die Gesellschaft zu bewerten, bevor es implementiert wird. Der Zweck ist die systematische Identifikation, Bewertung und Mitigation von Risiken.
Typische Dimensionen:
Betroffene Gruppen: Wer wird direkt oder indirekt beeinflusst (z. B. Bewerber, Kunden)?
Potenzielle Risiken: Diskriminierung durch Algorithmic Bias, Intransparenz, Sicherheitslücken, Arbeitsplatzveränderungen.
Mitigationsmaßnahmen: Definition von technischen (z. B. Fairness-Metriken) und organisatorischen (z. B. menschliche Aufsicht) Gegenmaßnahmen.
Solche Bewertungen sind ein Kernelement des Risikomanagement-Systems, das der EU AI Act (Art. 9) für Hochrisiko-Systeme vorschreibt.
Menschliche Aufsicht adressiert das „Black-Box“-Problem und stellt sicher, dass die finale Verantwortung bei Menschen und nicht bei Maschinen liegt. Der Zweck ist die Sicherstellung der menschlichen Kontrolle, Korrekturfähigkeit und Verantwortungsübernahme.
Typische Ausgestaltungen:
Governance-Gremien: Einrichten von Ethik- oder RAI-Boards, die strategische Entscheidungen treffen und kritische Anwendungsfälle prüfen.
Vier-Augen-Prinzip: Kritische, von KI getroffene Entscheidungen müssen von einer menschlichen Instanz validiert werden.
Technische Override-Funktionen: Anwender müssen die Möglichkeit haben, eine KI-Entscheidung manuell zu übersteuern oder das System anzuhalten.
Auditability stellt durch lückenlose Dokumentation sicher, dass jede Phase im Lebenszyklus einer KI-Anwendung transparent und nachvollziehbar ist. Der Zweck ist die lückenlose Rückverfolgung von Entscheidungen, Daten und Modelländerungen.
Typische Inhalte eines Audits:
Versions-Logs: Detaillierte Protokolle von Änderungen an Code, Daten, Modellen und Parametern.
Trainingsdatenquellen: Dokumentation, mit welchen Daten (inkl. Zeitstempel) ein Modell trainiert wurde.
Freigabeprotokolle: Nachweis, wer wann welche Modellversion mit welchen Testergebnissen genehmigt hat.
Die konsequente Umsetzung dieser RAI Frameworks führt zu greifbaren Wettbewerbsvorteilen:
Transparenz, Fairness und menschliche Kontrolle stärken das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden und Partnern in die KI-Systeme des Unternehmens (Kelly et al., 2022).
Ein proaktiver Governance-Ansatz sorgt für Rechtssicherheit und minimiert das Risiko hoher Strafen im Rahmen von Regulierungen wie dem EU AI Act und der DSGVO.
Ein nachweislich verantwortungsvoller Umgang mit KI positioniert das Unternehmen als ethischen und zukunftsfähigen Akteur und stärkt das Markenimage.
Das Fehlen einer solchen Governance-Struktur und der damit verbundenen Kontrollen ist einer der häufigsten und gravierendsten Stolpersteine auf dem Weg zur erfolgreichen und nachhaltigen KI-Implementierung.
Die analysierten Stolpersteine manifestieren sich in drei Kernbereichen: einer strategischen Lücke (fehlende Vision und Skalierungsplan), einer organisatorischen Lücke (ungeklärte Rollen, mangelnde Akzeptanz) und einer operativen Lücke (schwache Daten- und MLOps-Infrastruktur). Die Kenntnis dieser wiederkehrenden, aber vermeidbaren Fehler ist der erste Schritt zu ihrer Überwindung.
Viele KI-Projekte starten als isolierte Experimente ohne klare Anbindung an die Unternehmensstrategie. Es fehlt oft ein definierter Business Case, und die technische Infrastruktur ist nicht auf Skalierbarkeit ausgelegt. Ohne eine robuste MLOps-Praxis bleibt der Weg vom erfolgreichen Prototypen zum produktiven System versperrt.
Gegenmaßnahmen: Von Beginn an einen klaren Geschäftsplan definieren, der den Wertbeitrag quantifiziert. Parallel zum Piloten den Aufbau einer skalierbaren KI-Plattform vorantreiben und das Management frühzeitig für die Skalierungsphase gewinnen.
Eine fragmentierte IT-Landschaft, fehlende Data Governance und unzureichende Investitionen in die Dateninfrastruktur führen zu unzugänglichen oder unzuverlässigen Daten. Dies ist eine der größten Hürden für die KI-Adoption (Yang et al., 2024; Heimberger et al., 2024).
Gegenmaßnahmen: Etablierung einer dedizierten Rolle wie des Data Stewards, der die Datenqualität und -verfügbarkeit verantwortet. Aufbau zentraler Feature Stores, um eine „Single Source of Truth“ für Modelldaten zu schaffen und eine unternehmensweite Datenstrategie zu implementieren.
KI wird fälschlicherweise als reines IT-Projekt behandelt, ohne dass eine klare Verantwortung im Fachbereich (Business Ownership) definiert ist. Dies führt zu unklarer Rechenschaftspflicht („Unclear Accountability“) und mangelnder Ausrichtung am Geschäftswert.
Gegenmaßnahmen: Klare Definition und Besetzung der Schlüsselrollen wie Product Owner AI, der die Business-Ziele vertritt, und des RAI Officers, der die ethische und rechtliche Konformität sicherstellt.
Ein rein technokratischer Fokus auf die Machbarkeit führt zur Unterschätzung von Risiken wie Algorithmic Bias, Diskriminierung und mangelnder Transparenz. Ethische und gesellschaftliche Auswirkungen werden ignoriert.
Gegenmaßnahmen: Verbindliche Einführung von Responsible-AI-Kontrollen. Durchführung obligatorischer Impact Assessments und Ethical Audits vor der Implementierung kritischer KI-Systeme und Etablierung eines unternehmensweiten RAI-Frameworks.
Werden Mitarbeitende nicht in den Veränderungsprozess eingebunden, entstehen Ängste vor Arbeitsplatzverlust und Widerstand gegen die neue Technologie. Unzureichende Kommunikation und fehlende Qualifizierungsangebote verschärfen dieses Problem (Ruess et al., 2024).
Gegenmaßnahmen: Einführung partizipativer Gestaltungsformate, bei denen Mitarbeiter:innen aktiv an der Entwicklung der KI-Lösungen mitwirken. Gezielte Schulungsinitiativen, die von einer grundlegenden KI-Qualifizierung für alle bis hin zu Expertenwissen für Spezialrollen reichen, sowie eine offene und transparente Kommunikation über die Ziele und Auswirkungen der KI-Einführung.
Die Analyse dieser Stolpersteine zeigt, dass der Erfolg einer KI-Implementierung von einem ganzheitlichen Ansatz abhängt. Wer die typischen Probleme kennt, kann proaktiv die richtigen Lösungsansätze und Erfolgsfaktoren ableiten.
Aus der Analyse der häufigsten Stolpersteine lassen sich im Umkehrschluss die entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine wirksame KI-Transformation ableiten. Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese Faktoren systematisch und ganzheitlich adressieren.
Aus den betrachteten Studien (Heimberger et al., 2024 u. a.) kristallisieren sich folgende fünf zentrale Erfolgsfaktoren heraus:
Strategische Verankerung durch die Geschäftsführung: KI wird als Chefsache behandelt. Es gibt eine klare Vision, die in die Unternehmensstrategie integriert ist, und das Management stellt die notwendigen Ressourcen bereit.
Aufbau einer datengetriebenen Kultur und Infrastruktur: Daten werden als strategisches Asset behandelt. Investitionen in eine robuste Dateninfrastruktur, Data Governance und die Rolle des Data Stewards sind priorisiert.
Systematische Qualifizierung und Befähigung der Mitarbeiter:innen: Es gibt unternehmensweite Programme zum Aufbau von KI-Wissen sowie spezialisierte Trainings für die Expertenrollen. Partizipative Formate fördern die Akzeptanz und Einbindung.
Etablierung einer agilen und robusten MLOps-Praxis: KI wird über eine Plattform betrieben. Automatisierung, Monitoring und Skalierbarkeit sind von Beginn an eingeplant.
Verankerung von Responsible AI als Qualitätsmerkmal: Governance, Ethik und Compliance sind integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses und werden als vertrauensbildendes Differenzierungsmerkmal verstanden.
Basierend auf diesen Erfolgsfaktoren lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für die entscheidenden Akteure im Unternehmen ableiten.
Für die Geschäftsführung / Vorstand:
Phase 1 zur Chefsache erklären: Verankern Sie eine klare KI-Vision („Compelling Point of Arrival“) in der Unternehmensstrategie und tragen Sie diese persönlich in die Organisation. Kommunizieren Sie transparent und konsequent, um eine gemeinsame Ausrichtung und Dringlichkeit zu schaffen.
Investitionen strategisch priorisieren: Stellen Sie dedizierte und langfristige Budgets bereit, die nicht nur die Technologie, sondern vor allem auch die Qualifizierung der Mitarbeitenden und den Aufbau einer soliden Dateninfrastruktur abdecken.
Governance als Vertrauensanker etablieren: Schaffen Sie ein klares Responsible-AI-Framework als Leitplanke für alle KI-Initiativen. Besetzen Sie die Rolle eines RAI Officers mit den notwendigen Kompetenzen und Befugnissen, um Vertrauen bei Kunden, Partnern und Regulatoren sicherzustellen und Compliance-Risiken zu minimieren.
Für Fachbereiche (HR, IT, Data/Analytics):
HR als Change-Motor nutzen: Entwickeln Sie umfassende Qualifizierungs- und Umschulungsprogramme – von der Basis-KI-Qualifizierung bis hin zu Expertenschulungen. Fördern Sie aktiv eine Kultur des partizipativen Wandels, indem Sie Mitarbeitende frühzeitig in die Gestaltung von KI-Lösungen einbinden.
Die operative Exzellenz aus Phase 2 und 5 sicherstellen: Bauen Sie eine skalierbare KI-Plattform auf, die MLOps-Fähigkeiten (Phase 5) und einen zentralen Feature Store (Phase 2) bereitstellt, um die Entwicklung neuer Anwendungen zu beschleunigen.
Für Projektverantwortliche / Produktteams:
Nutzerzentriert und partizipativ arbeiten: Binden Sie Endanwender von Anfang an in den Entwicklungsprozess ein (Ruess et al., 2024). Nutzen Sie agile Methoden wie Design Thinking – eine Praxis, die bei KI-High-Performern um 30 % systematischer verankert ist –, um Lösungen zu schaffen, die echten Mehrwert bieten und auf hohe Akzeptanz stoßen.
Vom Piloten zur Implementierung denken: Planen Sie die Skalierbarkeit und den operativen Betrieb (MLOps) von Beginn an mit ein. Definieren Sie bereits in der PoC-Phase klare Kriterien für den Übergang in den produktiven Einsatz und stellen Sie sicher, dass die technische Architektur dies unterstützt.
Das in diesem Beitrag analysierte deutsche KI-Paradoxon – die Diskrepanz zwischen hoher technologischer Adoption und geringer strategischer Dringlichkeit – ist ein Warnsignal. Es zeigt, dass viele Unternehmen Gefahr laufen, das transformative Potenzial von KI zu verpassen, indem sie sich auf oberflächliche Effizienzgewinne beschränken. Die Überwindung dieses Paradoxons erfordert einen ganzheitlichen, strategischen Ansatz. Der Erfolg hängt nicht allein von der besten Technologie ab, sondern von der intelligenten Orchestrierung von Technologie, Organisation und Mensch. Ein strukturiertes Vorgehen, klare Verantwortlichkeiten, eine robuste Governance und die konsequente Befähigung der Mitarbeitenden sind die entscheidenden Hebel für eine wertstiftende und nachhaltige KI-Implementierung.
Die Rahmenbedingungen für den KI-Einsatz werden sich in den kommenden Jahren dynamisch weiterentwickeln. Drei Trends sind dabei von besonderer Bedeutung:
Mit der zunehmenden Verbindlichkeit des EU AI Acts wird eine proaktive KI-Governance von einer "Best Practice" zu einer nicht-verhandelbaren Notwendigkeit. Compliance wird zu einem zentralen Faktor im Design und Betrieb von KI-Systemen.
Die rasanten Fortschritte bei Generativer KI und die Entwicklung hin zu autonomen Agenten erschließen völlig neue Anwendungsfelder (Deloitte, CEO's Guide). Gleichzeitig erhöhen sie die Komplexität in Bezug auf Governance, Sicherheit und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
KI wird sich vom reinen Effizienztreiber zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für innovative Geschäftsmodelle entwickeln. Unternehmen, die KI nutzen, um ihre Produkte, Dienstleistungen und Kundenbeziehungen fundamental neu zu gestalten, werden sich im Markt durchsetzen (IW-Report, 2025).
Die Weichen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit werden jetzt gestellt. Unternehmen, die heute die organisatorischen und strategischen Grundlagen für eine skalierbare und verantwortungsvolle KI-Nutzung legen, sichern sich die entscheidenden Vorteile von morgen. Stellen Sie sich dafür als Organisation die folgenden 10 Fragen, bevor Sie Ihre KI-Transformation starten oder skalieren.
Vision & Strategie: Haben wir eine klare, vom Top-Management getragene KI-Vision, die über reine Kosteneinsparungen hinausgeht?
Business Case: Ist für jeden zentralen KI-Anwendungsfall ein klarer Business Case mit messbaren Zielen (KPIs) definiert?
Dateninfrastruktur: Ist unsere Dateninfrastruktur bereit für skalierbare KI-Anwendungen, oder behindern Datensilos und mangelnde Qualität unsere Ambitionen?
Rollen & Verantwortung: Sind die Verantwortlichkeiten für den gesamten KI-Lebenszyklus geklärt (z. B. Product Owner AI, Data Steward, RAI Officer)?
Kompetenzen: Haben wir einen konkreten Plan zur Qualifizierung unserer Mitarbeitenden – sowohl für eine breite KI Qualifizierung als auch für Expertenwissen?
Governance & Ethik: Haben wir ein Responsible-AI-Framework und wie planen wir systematische Impact Assessments für neue KI-Systeme?
Technologie & Plattform: Denken wir über einzelne Piloten hinaus und investieren in eine skalierbare KI-Plattform mit MLOps-Fähigkeiten?
Change Management: Wie binden wir unsere Mitarbeitenden aktiv in den Veränderungsprozess ein, um Akzeptanz zu sichern und Widerstände abzubauen?
Skalierung: Haben wir eine Strategie, wie wir erfolgreiche Piloten implementieren und über Abteilungsgrenzen hinweg skalieren ?
Erfolgsmessung: Wie verfolgen wir den quantitativen und qualitativen Wertbeitrag unserer KI-Initiativen?